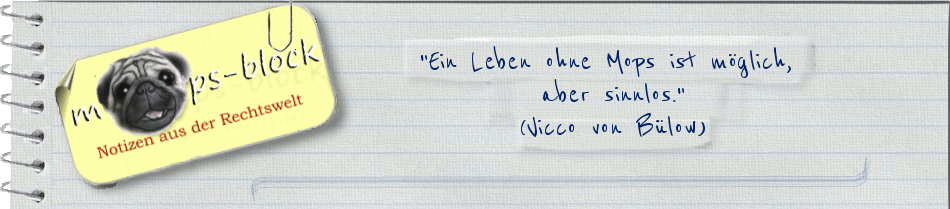Aus Anlass einer Bulgarienreise
Wer eine Reise unternimmt, sollte sich vorbereiten. Ich wollte nach Bulgarien fahren. Weil ich mich viel mit Byzantinistik beschäftigt habe und Bulgarien mit Byzanz eine lange und blutige Geschichte teilt. Außerdem hatte ich das (kürzlich auf Bulgarisch, leider immer noch nicht auf Deutsch erschienene) Buch von Jani Kirov gelesen - gedankenreiche, feinziselierte und sanft ironische bulgarische Rechtsgeschichten. Jetzt ist Bulgarien Mitglied der Europäischen Union.Deutschland auch, wenn auch schon länger. Die Bulgaren sind also meine europäischen Mitbürger. Aber ich wusste nichts von Ihnen, außer, daß Ihre Hauptstadt Sofia heißt und daß sie nicht der Euro-Zone angehören, sondern mit dem Lev (Plural: Leva) hantieren; außerdem erinnerte ich mich, daß ihr Anteil am Schwarzen Meer gern von den DDR-Insassen heimgesucht wurde, so daß man, wenn man unbedingt wollte, dort echte DDR-Menschen treffen konnte, was in der Regel dem Durchschnittswessi allerdings kaum erstrebenswert schien. Schließlich verehre ich einen toten Bulgaren namens Elias Canetti und kenne einen lebenden bulgarischen Rechtshistoriker (und zwar den besten - auch wenn das nur wenige wissen), nämlich eben jenen gerade zitierten Jani Kirov.
I.
Inzwischen hat sich mein dürftiges Wissen, jedenfalls soweit die DDR-Bürger betroffen sind, naturgemäß noch weiter vermindert. Konsequent erwarb ich einen Reiseführer. „Reise-Handbuch-Bulgarien“, heißt er, und ist von Dumont. Die erste und bislang letzte, Auflage stammt aus dem Jahre 2011. Für ein Land in „transition“ ist das eine lange Zeit - und in der Tat erweist sich der Führer im Hinblick auf den Aspekt „Unterkunft“ als nur wenig brauchbar. Mancherlei Herberge existiert nicht mehr; selbst die aufgelassenen Reste sind nur noch fallweise aufspürbar. Dafür sind manche andere neu entstanden und übertreffen an Komfort und im Preis-Leistungsverhältnis die einst ohnehin nur exemplarisch ausgewählten und beschriebenen Unterkünfte bei weitem.
Vom Schicksal des Veraltens wenig betroffen sind fraglos die Berichte über die reichlich vorhandenen thrakischen, griechisch-mazedonischen, römischen und byzantinischen Altertümer. Fraglos erreichen die Darstellungen nicht die Qualität, die einst (und jetzt nirgendwo) die sagenhaft detaillierten Beschreibungen des alten (!) Baedeker auszeichnete, aber von diesen Texten wurden seinerzeit auch andere Menschen geleitet als heute von Dumont: verklärte Humanisten, die ihrem Baedecker den Homer und einige antike Klassiker beigepackt hatten und im heutigen Bulgarien ausschließlich an den Spuren der Thraker und Makedonen - entfernt noch ein wenig an denen der Römer - interessiert gewesen wären. Mir waren die eher kursorischen, für archäologiegetrimmte Touristen ordentlich aufbereiteten Notizen eher zu viel. Denn wie man es auch dreht und wendet: der Umstand, daß vor den Bulgaren auf deren heutigem Staatsgebiet Griechen und Römer siedelten, macht diese allenfalls in einem dürftigen territorialen Sinn zu bulgarischen Vor-Fahren, so daß der an sie und ihre Hinterlassenschaften geknüpfte nationale Stolz der Bulgaren reichlich artifiziell wirkt.
Das gilt selbstverständlich nicht für die Byzantiner, deren Beitrag zur bulgarischen Geschichte nicht geringer ist als der von Diktator Todor Schiwkow und seiner Partei. Dass den Autoren des Reisehandbuchs (Simone Böcker/Georgi Palahutev) die byzantinischen Relikte sympathischer waren als die allerorten herumstehenden sozialistischen Zementtrophäen ist gewiß verständlich. Gleichwohl hätte deren Beschreibung etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Zwar sind diese durchweg monumentalen, gegossenen und/oder gemauerten Heldinnen und Helden für das Auge der Gegenwart wahre Scheußlichkeiten. Aber erstens gilt das nicht für alle Monumente, zweitens sind ästhetische Urteile historisch (schon die nächste Generation mag die uns verborgen gebliebene Schönheit entdecken – und umgekehrt) und drittens gehören diese Denkmäler nun einmal zur jüngsten bulgarischen Geschichte. Sie sollten etwas herausheben, etwas lehren und etwas unterstreichen, was zu kennen sich lohnt, wenn man die gerade verflossene Zeit verstehen will. Die weitgehende Vernachlässigung, häufig nicht einmal Erwähnung der Plastiken, Statuen und Gedenksteine, die sich freilich tatsächlich fast in jedem Dorf finden, ist nicht gerechtfertigt oder besser: scheint dem am heutigen Bulgarien interessierten Reisenden wichtiger als der Hinweis auf 10 Pflastersteine und ein Kapitell aus der Zeit Traians.
Ansonsten gibt es aber gegen den Dumont-Führer kaum etwas einzuwenden. Die Abteilung „Wissenswertes über Bulgarien“ (10-65) enthält wirklich viel Wissenswertes und müsste lediglich hier und da erneuert und ergänzt werden. Für „Wissenswertes für die Reise“ (68 - 99) gilt das Gleiche. Der Rest des Führers (103 - 415) ist auf 6 Kapitel aufgeteilt (Sofia und Umgebung, Rila- und Pirin-Gebirge, Balkan, Donauebene, Schwarzmeerküste, Südbulgarien) und erwies sich als zuverlässiger Wegbegleiter, dessen Informationen in 5 Wochen keineswegs restlos ausgeschöpft werden konnten. Besonders wertvoll und anregend sind die eingestreuten politischen, soziologischen und ökonomischen Analysen und Skizzen (über Plattenbauten, Mafia, Minderheiten etc.), die dem Verständnis nachhaltig aufhalfen. Insgesamt also: empfehlenswert.
II.
Reiseführer sind Orientierungshilfen. Zur Einstimmung hätte ich gern etwas Detailliertes, aber gleichwohl Kurzes und Solides über die Geschichte der deutsch-bulgarischen Beziehungen gelesen. Aber erst nach der Reise stieß ich auf den Aufsatz von Oliver Stein (Die deutsch-bulgarischen Beziehungen seit 1878, Zeitschrift für Balkanologie, 47, 2011, 218 - 235), dessen Aneignung wenigstens nachträglich eine große Lücke füllte und mich zugleich über die nicht eben magere Literatur zum Reiseland in Kenntnis setzte. Zuvor aber nahm ich – uninstruiert – Zuflucht zur Belletristik.
III.
Eine erste Empfehlung hatte mich auf Angelika Schrobsdorff hingewiesen. Die inzwischen 88jährige (24.12.1927) Schriftstellerin hat 1983 einen Text „Die Reise nach Sofia“ geschrieben, von dem sie versichert, „daß alle Personen, Situationen und Dialoge frei erfunden“ seien, was cum grano salis durchaus richtig sein mag, aber natürlich nichts daran ändert, daß es sich bei dem Buch um einen von subjektiven Erfahrungen gesättigten Bericht handelt.
Im ersten Kapitel des Buches (Seite 15-106 der dtv-Ausgabe, 18.Aufl.2008) beschreibt die Autorin die titelgebende Reise nach Sofia, die sie wegen des verschneiten dortigen Flugplatzes zunächst in den Osten nach dem 300 km entfernten Burgas und von dort nach freud- und komfortloser Übernachtung erst am nächsten Tag mit dem Zug nach Sofia führt. Wer jemals - und das werden allmählich immer weniger - in den Zeiten des blühenden Ostblocks eine Reise in den Sozialismus unternommen hat, wird ohne weiteres in den bürokratischen Kalamitäten, die dem Reisenden an nahezu jeder Station seines Unternehmens drohten und ebenso in den in der Regel unerwartet freundlichen Auflösungen derselben seine eigenen Reisegeschicke und Erfahrungen wiedererkennen. Zur Einstimmung in das heutige Bulgarien ist die amüsante Erzählung freilich nicht mehr geeignet, denn diese Verhältnisse sind ebenso wie die Menschen, die sie gestaltet haben, mit dem Sozialismus verschwunden.
Dasselbe gilt auch für die beiden anderen Kapitel des Buches, von denen das eine (Der Boiler, 109 - 155) den Austausch eines Boilers in der Wohnung von Freundin Ludmila unter Bedingungen und Möglichkeiten der Mangelwirtschaft beschreibt, während das 3. und letzte Stück (Der westliche Schock, 159 - 290) das Bulgarien der 80er Jahre wieder verlassen hat und die Freundin Ludmila auf Besuch in Paris zeigt. Schon vom Sujet her wird man hier also weniger auf Bulgarien, als auf einen einzelnen weiblichen bulgarischen Menschen eingestimmt, der zudem nach den Angaben der Autorin eine reine Kunstfigur sein soll.
In der Tat hat die Autorin in ihre „Freundin Ludmila“ die Gesamtheit aller Urteile und Vorurteile, die sie (und man) beim ersten Zusammenstoß eines Ostblockmenschen mit dem in Wohlleben und Luxus ertrinkenden dekadenten Westens beobachten konnte, projiziert und anschließend der bedauernswerten Protagonistin auch noch ihre eigene, die Schrobsdorffische Sozial- und Kulturkritik aufgeladen, so daß eine restlos unglaubwürdige Figur entstanden ist, deren Aktionen und Verhaltensweisen schwerlich noch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind: Ludmila, die Ärztin, hat eine Abneigung gegen die Pariser Punks („nicht normal“), die Prostituierten hätte sie gern unsichtbar, interracial sex veranlasst sie zu der Bemerkung „Sodom und Gomorrha“, und der Anblick arabischer Teilnehmer am Sex-Geschäft entlockt ihr ein „Die Araber sind Sex-Maniaken“. Aber auch Zigeuner und Türken zählen zum „Gesindel“, und die Neger „gehören doch in den Urwald und nicht nach Paris“. Kaffee und Croissants werden, weil unbekannt, zugunsten von gewohntem Nescafé und Brot verworfen; sie nimmt die Hundescheiße auf den Pariser Straßen übel; vom großartigen Fressalien - Angebot in der Rue Daguerre ist sie angeekelt („ich bin satt. Ich brauche nichts“) und nicht, wie (von wem?) erwartet, begeistert. Sie steckt die Filterzigarette verkehrt herum in den Mund, weiß nicht, was Austern sind oder wie man ein Feuerzeug anknipst, steht aber auf Bananen, wie „jeder Bulgare“. Homosexuelle sind ihr rätselhaft („Er sieht doch aus wie ein ganz normaler Mann, man merkt ihm doch überhaupt nichts an“); sie betätigt sich an einem Amerikaner als Lebensretterin, lehnt aber eine Vergütung ab, weil „die Amerikaner überzeugt sind, daß wir armen, unterentwickelten Menschen vor Glück vergehen, wenn man uns einen Geldschein in die Tasche steckt“.
Kurzum: „In Ludmila kämpften […] archaischer, balkanesischer Stolz mit Minderwertigkeitskomplexen dem Westen gegenüber, Faszination für diese Welt des Luxus mit Groll auf die Krümel, die daraus für sie abfielen, Hilflosigkeit mit Überheblichkeit“.
Am Ende verlässt sie, halbwegs versöhnt (Es ist nicht alles Gold was glänzt, aber „der Glanz ist trotzdem nicht zu verachten“), aber nicht geheilt Paris und fährt zu Tante Ratka nach Deutschland.
Heute muß ein Bulgare nicht mehr nach Paris fahren, um sich einen westlichen Schock zuzuziehen. Er kann ihn sich im eigenen Lande holen.
IV.
Im Anhang zur „Reise nach Sofia“ hat der Verlag, um den auf den Geschmack gekommenen Leser nicht unversorgt zu lassen, zwölf weitere Buchtitel von Angelika Schrobsdorff aufgelistet. Ich stoße auf „Grandhotel Bulgaria. Heimkehr in die Vergangenheit“. Der Text ist 1997 erschienen und verhehlt nicht seine autobiographische Signatur. Zwar taucht die in der „Reise“ als „frei erfunden“ bezeichnete Freundin Ludmila, die tablettensüchtige Ärztin, auch hier mehrfach auf (20, 229, 270), aber man spürt sofort, daß jetzt die echte Erinnerung an die inzwischen aus dem Leben Geschiedene wirksam ist.
Getrieben von ihrer „Sehnsucht nach der Vergangenheit und Jugend“ (63) macht sich die Autorin aus einem wilden Leben zurück auf die Suche nach jenem Bulgarien, in das sie, 1927 in Freiburg geboren, 1939 mit ihrer jüdischen Mutter geflohen ist und das sie 1947 - nicht mehr Deutsche und doch nicht Bulgarin - wieder zugunsten Deutschlands verlies, ohne dort dann aber Ruhe und schon gar nicht gelassene Zufriedenheit zu finden. Während der „Reise“ lebt sie in Paris, bei der „Heimkehr" in Israel, wo sie vergebens „mit inbrünstigem Gesicht gehofft, mit Rührung gelauscht, mit Einfalt auf einen neuen Aufbruch gewartet“ hat (187). Inzwischen wohnt die Unglückliche in Berlin und gibt dem STERN (Sept.2008) an sich und am Alter verzweifelnde Interviews.
(http://www.stern.de/kultur/buecher/angelika-schrobsdorff--ich-habe-nie-geliebt--3744010.html)
Auch das in diesem Buch beschriebene Bulgarien ist zweifellos Geschichte. Wir befinden uns nicht mehr im kommunistischen Bulgarien, das 1945 begann und 1989 endete, sondern im Postsozialismus der 90er Jahre, aber noch vor dem 1. Januar 2007, mit dem der EU-Beitritt Bulgariens wirksam wurde. Das waren 18 Jahre, die mit großen Hoffnungen und Erwartungen begonnen hatten und ziemlich rasch in jähem Zusammenbruch endeten, so daß es - eben zu der Zeit als Schrobsdorff „heimkehrte“ - jenen, die unter den Kommunisten ein erfolgreiches Leben geführt hatten, in der Regel deutlich schlechter ging als zuvor, und jenen, denen es schlecht gegangen und ergangen war, ging es nicht wirklich besser, ein Klima, in dem man Verdrießlichkeit, Hass und Verzweiflung, aber keine optimistischen Regungen erwarten darf. Diesen Zustand hat das Land im Jahr 2015 zweifellos überwunden, so dass man als prospektiv auf Einstimmung in Land und Leute hoffender Reisender auch aus diesem Buch nur geringen Nutzen zieht.
Manches hat sich freilich auch nicht geändert. So die Abneigung der Bulgaren gegen die Roma, die sich immer noch in Abwehr und Schauergeschichten äußert. Die Autorin macht Station in Sofia und lässt sich von dort durch ein befreundetes Faktotum, den Ingenieur und Ex-Gastarbeiter Bogdan, das „Gottesgeschenk“, zu Besuchen und ihren Plätzen der Erinnerung chauffieren. Sie möchte auch einen Blick auf das Zigeunerlager von Sofia werfen. Aber Bogdan weigert sich.
„Hast Du Angst vor den Zigeunern oder was?“
„Ja, habe ich Angst. Schmeißen sie dir Kind unter Auto.“
„Wie bitte?“
„Ist schon paarmal passiert. Muß ich zahlen für Kind eine ganze Leben nur, weil Du willst Blick werfen auf Lager.“ (59)
„Zigeuner, gut als gebratene Hühner, die von Hochspannungsleitung fallen“ (100)
Außerdem beweisen manche Erscheinungen der Gegenwart leider immer noch die Trefflichkeit der Urteile Schrobsdorffscher Gesprächspartner aus den 90er Jahren.
„Man kann keine vollständige, fähige und erfahrene demokratische Regierung nach 40 Jahren Diktatur plötzlich aus dem Boden stampfen, und als sie gebildet wurde, fehlte es an demokratisch geschulten Führungskräften.“ (93)
Und für eine Festellung wie diese
„Die Wende hat die Bulgaren vor Aufgaben gestellt, die sie schlicht und einfach nicht fähig waren, zu erfüllen. Bulgarien war das linientreueste Land unter den Ostblockstaaten […] Meilen hinter dem technologischen Fortschritt zurück, wirtschaftlich kaputt. […] Es war ein Leichtes, das Volk zurückzupfeifen und von vorn bis hinten zu belügen. Viele haben bis heute nicht erkannt, was für ein dreckiges Spiel mit ihnen gespielt wird und daß sie alles von dieser Mafiaregierung erwarten können, alles, nur kein menschenwürdiges Dasein“. (94)
kann man überall im Land immer noch eine Gewährsfrau oder einen Gewährsmann finden
Im übrigen aber sind die durchweg in melancholischem Ton gehaltenen Schilderungen eines ausweglos trostlosen Alltags all jener, denen die von tiefer Liebe zum Gastland ihrer Jugend bewegte Schriftstellerin begegnet, eines Alltags, für den eine Besserung nicht erwartet werden darf, heute kaum noch generalisierbar.
Die markigen Sprüche des Bulgaren und Bulgarenkritikers Bogdan
„Die, die heute sind kriminell und Mafia, waren früher Kommunisten. Haben sie damals Bulgarien kaputtgemacht mit Ideologie, machen sie kleine Rest jetzt kaputt für Geld“ (63)
„Gäbe alles, wenn gäbe Menschen, die wollen arbeiten. Bulgaren wollen nicht mehr arbeiten, besonders nicht in Landwirtschaft“ (68),
„Haben sie die Nase voll und den Glauben an Bulgarien verloren. Sind sie unpolitisch. Haben sie nur ein Ziel: raus aus diese Land und in Westen viel Geld verdienen“ [= jumge Leutze] (188),
haben den Gipfel ihrer Gültigkeit eindeutig überschritten.
Auf die verhärmten Gesichter, abgetragenen, oft gewendeten und geänderten Kleidungsstücke, Jeans und Anoraks billigster Ausführung, auf das Grau abgerissener Gestalten, die umher schlurfen - auf diese ganze Elendsmelodie, die Angelika Schrobsdorff gewiß korrekt entdeckt und für Sofia komponiert hat, braucht sich der heutige Beobachter erfreulicherweise nicht mehr einzustellen, so daß der Lehrwert der Reiselektüre an dieser Stelle gering ist..
Entschädigt wird man freilich durch den weitherzigen und liebevollen Blick, den die Autorin auf die Menschen wirft, die sie besucht, und durch die großzügigen Einblicke, die die Freiburger Jüdin, deren Familie „überall und nirgends“ lebt, dem Leser in ihr eigenes, unruhiges und wohl selten glückliches Leben gewährt.
V.
Gisela Lerch schenkte mir „zur Reisevorbereitung“ Apostoloff, einen Roman von Sibylle Lewitscharoff (2010, 7. Aufl.2014, 248 S.) Post festum erst sah ich, daß auch mein Dumont-Führer (S. 70) unter dem Stichwort „Lesetipps“ ein halbes Dutzend Bücher empfohlen hatte, darunter das Grandhotel Bulgaria von Schrobsdorff und Apostoloff von Lewitscharoff, wobei zu letzterem bemerkt wurde, daß es „nur eingeschränkt als Reiseeinstimmung geeignet“ sei, ohne daß man erfahren hätte, was diese Einschränkung motiviert haben könnte, soll doch, laut Klappentext, Volker Rabe im SPlEGEL das Buch „erzkomisch“ gefunden und als „sprühende, vergnügliche Literatur“ bezeichnet haben.
Was die „Einstimmung“ betrifft, fällt das Buch zweifellos eher in die Klasse der literarischen Apotropäika.
„Das bulgarische Essen? Ein in schlechtem Öl ersoffener Matsch. Der Fisch ein verkokelter Witzfisch. Bulgarische Kunst im 20. Jahrhundert? Abscheulich, und zwar ohne jede Ausnahme. Die Architektur, sofern nicht Klöster, Moscheen oder Handelshäuser aus dem 19. Jahrhundert? Ein Verbrechen!“ (13)
Wer anders als ein unheilbarer Masochist würde bei solcher Einstimmung geneigt sein, eine Reise nach Bulgarien zu buchen?
„Wir haben Bulgarien schon satt, bevor wir es richtig kennengelernt haben. Traurig, aber wahr, die bulgarische Sprache dünkt uns die abscheulichste von der Welt. So eine weichliche, plump vorwärtsplatzende Sprache, labiale Knaller, die nicht zünden wollen.“ (14)
Traurig, aber wahr: ich habe das Buch schon nach den ersten 15 Seiten satt. Aber natürlich liest man doch immer weiter, voller vergeblicher Hoffnung, die Autorin werde sich irgendwann besinnen und erklären, dass alles – oder wenigstens das Meiste – gar nicht so gemeint oder ironisch gesagt gewesen sei. Nichts da. Unbeirrt fährt die Icherzählerin, die man nicht unbedingt mit der Lewitscharoff in eins setzen muss (siehe: „Roman“!) fort, ihren Gegenstand zu schmähen
„Miezmiez, sage ich zu einem Hund, da sich mein Bedürfnis, die Bulgaren lächerlich zu machen, auch auf ihre Hunde erstreckt“ (39).
Voller Abscheu auf Kommunismus und Sozialismus, die das Land ruiniert und seine Bevölkerung „der radikalen geistigen Schrumpfung ins Enge, Paranoide, Kassenwarthafte“ zugeführt haben, begleitet die Autorin „eine Trauerreise der besonderen Art“, die die mittels Gefriertechnik handsam reduzierten Überreste einer einst (1945!) zwanzigköpfigen Bulgarenbrigade von Stuttgart nach Sofia überführt. Da ihr kryotechnisch behandelter Vater – kein typischer Bulgare, da von dessen Elementen („ist stark behaart, hat perfekte weiße Zähne, ißt Knoblauch und wird steinalt“) einige fehlen – zu den Heimreisenden gehört, begleitet ihn die Erzählerin mit ihrer Schwester zu seinem neuen Grab. Anschließend unternehmen die Damen mit Rumen Apostoloff, einem entfernten Verwandten, der das Geschwisterpaar chauffiert, eine Rundreise durch das einst schöne, jetzt miese Bulgarien. Man hört viel vom Vater, an dem kaum etwas Gutes gewesen zu sein scheint („Zur halben Ehrenrettung unseres ansonsten nicht zu rettenden Vaters sei erwähnt, daß er es nach dem Krieg mit Willy Brandt hielt …“), viel auch von der Schwester und ihrem sich langsam entwickelnden Techtelmechtel mit dem titelspendenden Apostoloff, ein bißchen von den Bulgaren („bei den wie Irrsinnige auf die Farbe blond fixierten Bulgaren“; “Bulgarien, wie es ist, kommt in den Köpfen der Bulgaren kaum vor“; „alle Leute wirken wie Leute, die sich selbst als gestrandete sehen“ ).
Auf der Reiseroute des Trios tauchen nach und nach die genormten Ziele des nicht sehr entwickelten Bulgarientourismus auf: Veliko Tornovo („nicht ganz so übel wie gedacht“); das schwarze Meer („aschgrau“, „leergefischt“; „ein völlig unscheinbares, um nicht zu sagen ödes Meer“, „Wozu Meer, wenn es am Meer hässlicher ist als in Berlin“); Nessebar („Das bulgarische Elend wie es leibt und lebt“, “Kreischladungen der internationalen Hysterie werden auf die Straße gekippt“, „eine Ohrhölle“); Varna („für eine Stadt die am Wasser liegt, eine sehr alte Stadt sogar, ist sie bitter enttäuschend“); die Tombul-Moschee in Schumen („das einzige Bauwerk, das in Schumen eine Besichtigung lohnt“); das Monument „1300 Jahre Bulgarien“ („Dreck. Zwingdreck. Kraftdreck. Volksdreck. […] Grober Dreck, mißschaffener Dreck, widerwärtiger, erpresserischer Dreck …“); der Reiter von Madara; die Schwarzmeerküste („Verbaut, verpatzt, verdreckt“,); Burgas („vollständige Abwesenheit von Verkehrsregeln“); Melnik („die Weine und das Essen, die in Melnik auf den Tisch kamen ärgerten …“) Plovdiv („der übliche zerfressene Plunder“) usw. usf. Nur dem Kloster Arbanassi wird Absolution zuteil („inspiriertes Gold, das beim Sich weiten der Lungenflügel funkelt, beim Ausatmen schimmert und verlischt. Entzücktes Gold, gewecktes Gold und dann wieder Schlummergold, das im Dunkel versinkt“), gewährt es doch der Erzählerin eine Art kurzfristiger spiritueller Entrückung.
Angesichts solcher Wut erweist sich das Urteil des Dumont-Führers zur nur bedingten Einstimmungstauglichkeit dieses Textes schon fast als Huldigung, während die Epitheta „erzkomisch“ und „vergnüglich“ aus dem Klappentext ernste Fragen nach der Psyche des Urteilers aufwerfen.
Ich habe das Buch, dessen literarische Qualität zweifellos jene der Texte der eilfertig plaudernden Schrobsdorff erheblich übersteigt, mit wachsendem Missvergnügen gelesen.
Eine strikte Bewunderung muss einem allerdings der Rigorismus abnötigen, mit dem die Icherzählerin mit sich selbst umgeht. Während doch in der Regel Schriftsteller, wenn sie, wie fiktiv oder nicht auch immer, in eigener Person auftreten, recht schonsam mit sich umzugehen pflegen, lässt diese Autorin keine Gelegenheit verstreichen, sich selbst so nachdrücklich als Kotzpille zu stilisieren, daß man schließlich geneigt ist, ihr zu glauben.
VI.
Ein Volltreffer war Ilija Trojanow: Wo Orpheus begraben liegt, Hanser 2013, 220 S., ein Buch mit kurzen Geschichten von Trojanow und Fotografien von Christian Muhrbeck - Fotografien, die nicht bezwecken, die Geschichten zu illustrieren, sondern die sie kommentieren, weiterführen und sich auch die Freiheit nehmen, andere Geschichten parallel zu erzählen. Viele dieser Bilder - leider nicht alle und nicht genug - habe ich auch gesehen: geschmückte und tanzende Frauen, die Alten und die Jungen, die Hoffenden und die Erloschenen, riesige noch in der Frucht stehende oder schon abgeerntete Felder, den melancholischen Fluss, den einsamen Bauern, verhärmte Gesichter und fröhliche Mienen, die Müllhaufen und Wohnkästen, industrielle Reste, martialische Relikte, die Versprechungen der Orthodoxie, Visagen, stumpf und dumpf wie feuchtes Stroh und Gesichter, in die Geschichte und Geschichten so warme Runen gruben, daß man nicht wegsehen kann, Welthauch der Moderne und Behelfsheime, Behelfskleider, Behelfsgeschirr, Altbewährtes und schmuckes Neues.
Eine großartige Sehhilfe, die mir Enzio Wetzel, der Leiter des Goethe-Instituts in Sofia, beim Aufbruch ins Land noch schnell in die Hand drückte.
Die neun Geschichten von Trojanow bleiben hinter den mächtigen schwarz-weißen Bildern des Christian Muhrbeck nicht zurück. Ob er eine „Sippschaft“ denkt oder einen Journalistinnen-Trip in die Provinz zur Beerdigung eines 100jährigen („Totenfeier“) nachfühlt, ob er ironisch redet, wie beim Vorschlag, die Denkmalsucht der Bulgaren durch ein Monument zu Ehren der Gicht zu krönen („Denkmalvordenker“) oder schwermütig, wenn er auf die Ausgemusterten an der Donau („Donaufischer“) blickt, ob er voll grimmiger Empathie über die Zigeuner („Dale“) spricht oder die Zerstörungen eines Unangepassten schildert („Rückkehr“), immer geschieht dies knapp, intensiv und dicht, so daß man die Figuren derart lebendig aufsteigen sieht, daß die Chance, ihren Verwandten im heutigen Bulgarien zu begegnen, realistisch wird und real wurde.
VII.
Solcherart auf Trojanow aufmerksam geworden, hätte Grund bestanden, noch eben schnell auf die Dumont -Empfehlung „Ilja Trojanow, Die fingierte Revolution“, von 2006 zurückzugreifen. Aber der Autor kam mir zuvor, indem er „Macht und Widerstand“ (Fischer 2015) publizierte, was ich (nach der Rückkehr) auf der Stelle verschlang. Der Text stellt sich als „Roman“ vor, begegnet dem Leser aber eher als literarisch bearbeitete Dokumentation.
Zwei Figuren, zwei Typen, zusammengesetzt aus Erfahrungen, Gesprächen, Dokumenten und in die Passform fiktiver Schulkameraden und Altersgenossen gegossen, der eine auf der Seite der Herrschenden (Metodi), der andere auf der Seite der Herrschaftsgegner (Konstantin). Zwei Kunstfiguren, denen man die Kunst anmerkt, was die noch auf der Reise konsumierte Kritik angeleitet haben mag, die vielstimmig die mangelnde literarische Qualität des „Romans“ beklagt. Zwischen den Auftritten der Figuren eingestreut: viele (echte) Dokumente, Listen, Protokolle, Archivmaterial sowie kleine Berichte des Berichterstatters Trojanow aus der kommunistischen und postsozialistischen Zeit, winzige, gut erzählte Lebenssplitter, wie sie auch in die beiden Prototypen aus der Zeit der Repression Eingang gefunden haben, so ungemein lebendig , daß sie jeder, der die Verwirrungen beobachten durfte, die der Postsozialismus in Verstand und Gefühl des überdurchschnittlichen DDR-Menschen wehte, auf der Stelle identifiziert, wiedererkennt und sich freut, daß der ästhetisch-literarische Raum sich als eng und kahl erweist.
Konstantin Scheitanow, 20 Jahre Haft wegen eines Bombenanschlags auf eine Statue des Genossen Stalin, davon 10 Jahre abgesessen, verprügelt, psychiatriert, gefoltert, liest Staatssicherheitsakten: die Entdeckung der Verräter und die Entdeckung der Fortdauer des Verrats, die Enttäuschungen der Freiheit, die Unmöglichkeit der Kompensation von Haft und Verfolgung, Rache ohne Befriedigung, Euphorie und Melancholie.
Metodi Popow, Metodski für die Vertrauten, Meto für die Liebsten, Parteisoldat und Karrierist, Generloberst a.D., Mitglied im ZK der BKP usw., als sich alles wendet: „Genosse a.D. und Bürger in spe“, ergo „Biznisman“, immer oben schwimmend („Der starke Hund fickt“), zufrieden und selbstzufrieden, wenn Scheitanow nicht wäre. Scheitanow erst Menetekel, dann machtloser Vorwurf. Metodi trumpft auf: alles war richtig, Metodi ist wütend - wo sind die Werte? Metodi zitiert Botev „Wer im Kampf für die Freiheit fällt, der stirbt nicht“, Metodi liebt das Pathos und die Weiber, Metodi ist weinerlich, irgendwo ist das gute Gewissen doch schlecht, Metodi schreibt keine Rechtfertigungsliteratur: „Heutzutage schiebt sich jeder den Stift in den Arsch und gibt seine Kacke als der Wahrheit letzten Schiss aus“.
Die Rahmenhandlung ist ohne Belang.
Einstimmungstauglich für Bulgarien? Kaum. Für Artung und Verwüstung des unterdrückten und des unterdrückenden Menschen? Allemal.
VIII.
Bei Enzio Wetzel bedanke ich mich für die Bekanntmachung mit Trojanow. Wir sprechen über die bulgarische Kritik an „Macht und Widerstand“. Neben dem Tadel an der Form („Roman“) spielt auch der Umstand, dass der Autor Deutscher ist, eine gewisse Rolle. Exilbulgare, schon 1971 mit seinen Eltern abgehauen, damals 6 Jahre alt, kommt jetzt daher und will uns erklären, wie es damals war und heute ist. Wie gut ich diese Argumente kenne. Anders als Wetzel habe ich sie schon zwischen 1947 und 1952 vernehmen können als die rückkehrwilligen Emigranten auf die vielfach Zurückgebliebenen stießen.
„Einstimmung“ stehe jetzt wohl nicht mehr auf meiner Motivationsliste, meint Wetzel, und empfiehlt mir „gleichwohl“ Georgi Gospodinov, der, wenn nicht als „Einführer“, so doch als bulgarischer Schriftsteller der Gegenwart ein sehr interessanter Autor sei.
Also besorge ich mir „Physik der Schwermut“ und ergötze mich post festum an der wunderbaren Phantasie dieses in Jambol geborenen Dichters und Schriftstellers.
Der dürre Klappentext besagt, es gehe um einen Erzähler, der an übergroßer Empathie leide „er kann und muss sich in alles einfühlen“. Zweifellos kann man die Episoden und Montagen so lesen. Man kann sich auch auf den in immer neuen Anläufen als unerschöpflich nachgewiesenen Mythos vom Minotaurus konzentrieren. Aber am besten fährt man, wenn man das reiche Buch als eine melancholische und unermüdliche Auseinandersetzung mit der Zeit, unserer Zeit, seiner Zeit, jeder Zeit, der Zeit an sich liest. Daß der Autor, wie ein Beobachter bemerkt, „viel Sinn für Schabernack“ hat, tut dem Ganzen keinen Abbruch, sondern entlastet.
Je mehr ich mich in dessen phantastische Welt einlasse und je öfter ich denke, einer seiner Sätze könne vielleicht genügen für einen Tag („Das Alter ist ein Sich-Gewöhnen“), umso neugieriger werde ich auf diesen Mann. Im Zeitalter des Internet hat man keine Schwierigkeiten, seine Neugierde zu befriedigen. Ich erfahre beschämt, was andere zweifellos schon seit Jahrzehnten wissen. Gospodinov ist längst eine berühmte Figur. „Die wichtigste literarische Stimme seines Landes“, wusste die FAZ schon 2010.
Der Mann mit dem ebenso nachdenklichen wie listigen Gesicht hat schon eine Menge geschrieben. Gedichte. Texte. Gaustín oder der Mensch mit den vielen Namen (er tritt auch in der ‚Physik der Schwermut‘ auf), Poesie des Banalen, Natürlicher Roman („hat ihn international bekanntgemacht“) usw. Ich werde wohl alles lesen müsse