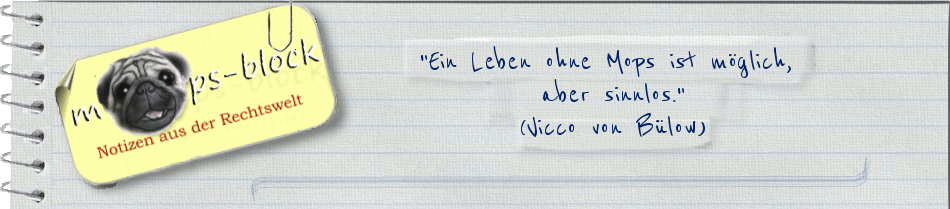Am 4. und 5. Juli fand im Deutschen Literaturarchiv in Marbach eine Tagung über Carl Schmitt statt. Ich fuhr hin. Mit dem Auto und drei Doktoranden (Vera Finger, Sophia Gluth und Alexander Lazovic). Von Berlin nach Marbach ist es weit und Autofahren ist langweilig.
Also nahm ich einen Text mit, der äußerlich Reisebedingungen entsprach (dünn = 84 Seiten, kleinformatig = 8,7 x 15,2 cm) und dem innerlich das Interesse der Vier gewiss sein sollte („Wie die Nase zum Riechorgan wurde“ von Harald Kleinschmitt, Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin, 2013), auf daß man sich wechselseitig vorlese. Schließlich ist die Nase größter Aufmerksamkeit wert. Von der eher befremdlichen Liebesnotiz aus dem Hohelied Salomos (4.4: „Deine Nase ist wie der Turm auf dem Libanon“) über die Nase der Kleopatra, Zwergnase, Pinocchio, Gogol, Süskind, einschließlich des strafweisen Naseabschneidens bei den Byzantinern fällt dem Abendländer umgehend allerhand ein. Als wir in Marbach eintrafen, ahnten wir allerdings bereits, daß dies wohl eher für uns als für den Autor Kleinschmidt gelten werde, der laut Klappentext als Professor für Geschichte an der Universität Tsukuba (60 km nordöstlich von Tokio) werkelt.
Marbach ist süß. Überall sieht man Fachwerk, Flädlesuppe, Maultaschen und Käsespätzle. Fleisch gibt es aber auch. Und Schiller. Friedrich Schiller ist dort geboren. Das genügt für ein Schiller-Nationalmuseum, Schiller-Geburtshaus, Schiller-Apotheke, Schillerhof (wir wohnten, nachdrücklich zu empfehlen, im „Hotel zum Bären“), Schiller-Volkshochschule, Schiller-
Gymnasium, Schiller-Antiquariat usw. Alles schillert. Einen Schiller-Hafen am Neckar konnten wir allerdings nicht ermitteln. Aber wir waren schließlich (und pünktlich) wegen Carl Schmitt gekommen.
Der Tagungstitel hieß „Carl Schmitt und die Literatur seiner Zeit“. Eingeladen hatten Ulrich Raulff, der (abwesende) Direktor des Literaturarchivs und Gerd Giesler, der Vorsitzende der Carl Schmitt-Gesellschaft e.V. Die Thyssen Stiftung hatte (mit-)gefördert. Begrüßt wurden die etwa sechzig im Kilian-Steiner-Saal des Literaturarchivs (auf der Schiller-Höhe!!) Anwesenden von Marcel Lepper, der Raulff vertrat und versprach, daß es um die Intervention von Carl Schmitt in die Literatur und umgekehrt, das Eindringen der Literatur in Carl Schmitt, gehen werde. Letzteres blieb freilich unerörtert, weil der einzige hierfür in Betracht kommende Vortrag („Das politisch-literarische Umfeld Carl Schmitts um 1918: Theodor Däubler, Hugo Ball, Franz Blei, Theodor Haecker, Konrad Weiß“) vom besinnlich im Saal sitzenden Stefan Schlak (Berlin) aus unbekannten Gründen nicht gehalten wurde. Ansonsten bleibt von der Begrüßung wesentlich ein Schnellfeuer von „liebe…, liebe …, liebe …“ in Erinnerung.
Die Moderation war für den Nachmittag dem Berliner Florian Meinel zugedacht, in dessen Händen (?) sie auch am nächsten Vormittag (anstatt in denen des angekündigten, aber entschwundenen Marcel Lepper) noch lag. Bekommen ist ihr das nicht. Von gelungener Vorstellung der Sprecher konnte mangels intensiver Vorbereitung und fehlender Sachkenntnis keine Rede sein, die Performanz der Worterteilung erinnerte an einen matten Auktionator, und der einzige prominente Ausländer (Helge Høibraaten aus Norwegen) wurde am Freitag zur Mittagszeit geradezu misshandelt. Da der Moderator nicht nur nachdrücklich darauf hinwies, daß man jetzt etwas eilig sei, sondern auch für peinliche Minuten vergeblich nach Notizen suchte, aus denen er hätte entnehmen können, wer das denn sei, der jetzt aufs Podium geklettert war, wurde die Vorstellung kurzerhand auf den Vorzustellenden delegiert, der, entsprechend mürrisch, lediglich bekundete, er habe sich mit CS befasst, seinen Vortrag („Sören Kierkegaard und Carl Schmitt – existenziell und literarisch“) abhaspelte und Hals über Kopf verschwand, so daß nicht nur die landesübliche, für Referenten, power point, Mikrofon, Verdunkelung etc. zuständige high heels-Blondine nicht mehr einzugreifen brauchte, sondern auch das Schlusswort umstandslos geopfert werden konnte.
Am Donnerstagabend hingegen moderierte Gerd Giesler, der die Sache sehr gut machte. Er hatte den Schriftsteller Martin Mosebach vorzustellen, was schon wegen der überzeugend einsetzbaren rhetorischen Floskel „brauche ich nicht vorzustellen“ mühelos gelang und nach dem Vortrag erneut glückte, mittels geschickt in Szene gesetzter Überwältigung durch den Redner Mosebach, die die diskussionslose Verabschiedung des Publikums in den Empfang erlaubte, so daß den etwa 150 dankbaren Anwesenden die Anhörung der in solchen Fällen ausnahmslos unerquicklichen Befragungen, Belästigungen und Bedrängungen des Redners erspart blieb.
Mosebach (Frankfurt/Main) redete, nach eher ungeschickter Einleitung über die Verbindung seines Themas mit dem Freund/Feind-Modell von CS, mit auf den Rücken gelegten Händen und leicht blechernem Pathos über das Thema „Der Feind“, d.h. er trug sechs eindrucksvolle Episoden vor, gut gewählt und gut verteilt über Zeit und Raum (Feindschaft des Brahmanen, Die Skulptur des Feindes, Die Feindschaft Parzivals, Lob des Faustrechts, Morden ohne Hass, Feindschaft in nuce). Überragend die Interpretation der Skulptur des Barbarenkönigs Amykos und besonders bedrückend die Beobachtungen des Schriftstellers zum innigen Hass gegenüber zwei Alten. Eine Lesung, die wegen der Eleganz des Textes und dessen moralischer Anregung schon für sich die Reise gerechtfertigt hat.
Und Carl Schmitt? Hörten wir etwas über Reinhard Mehring Hinausgehendes, etwas anderes als „Kronjurist“ + Abscheu + Antisemitismus und Plettenberg?
Durchaus.
Sieht man von dem ergiebigen und eindringlichen Vortrag des Konstanzer Juristen Christoph Schönberger ab, dem es gelang, ausgehend von seiner für die Neuzeit durchaus plausiblen Prämisse, die Sprache der Juristen sei antirhetorisch („objektiv“, „kalt“, „sachlich“, „ernsthaft“) angelegt, den in der Weimarer Republik erfolgten Übergang Schmitts in die literarisch-ästhetische Rechtsproduktion als Flucht aus der Irrationalität zu deuten, mit der hübschen Pointe, daß der Einbruch der Literatur in das Rechtsdenken des Carl Schmitt in dem Augenblick erfolgte als er ganz zum Juristen wurde - sieht man also von dieser umfassenden „Drei-Phasen-Literaturgeschichte-CS“ ab, beeindruckten nur noch die Editionsberichte der mit den Tagebüchern 1921 - 1924 befassten Redner (Helmut Lethen, Wolfgang Spindler, Lorenz Jäger).
Diese von Schmitt für den eigenen Gebrauch (er las, mit Datierung am Rande, immer wieder einmal in ihnen), für die eigene Besinnung und die persönliche Rechenschaft geschriebenen, genauer: in der heute nur noch von Wenigen beherrschten Gabelsberger Kurzschrift verfassten Tagebücher, deren Erscheinen unmittelbar bevorsteht, zeigen einen Mann in seinen frühen Dreißigern, der mit einer wilden Radikalität, einer erstaunlichen Kraft und einer fast verzweifelnden Wut sich täglich aufs Neue befragt: Wer bin ich? Warum bin ich? Was will ich? Was glaube ich? Was soll ich? 
Ein Mann der mit sich hadert, sich verurteilt und sich preist, zerknirscht und größenwahnsinnig zugleich.
Gedanken und Äußerungen, wie sie landläufig jungen Menschen zugeschrieben werden, die sich anschicken, sich als Mensch zu denken, Gedanken, die wohl auch (hoffentlich) den einen oder anderen Editor oder Leser befallen haben mögen, nur daß die sie nicht niedergeschrieben und, um ihrer Behaglichkeit willen, alsbald verdrängt haben, so daß sie heute derlei Fragen und Antworten nicht ungern als „pubertär“ abtun, ganz so, als ob es sich bei Verdrängung und „Erwachsenwerden“ keineswegs auch um einen Verlust, sondern lediglich um einen positiven und rückhaltlos zu feiernden Vorgang gehandelt habe.
Vielleicht hat auch mancher Mann unter ihnen dreimal täglich onaniert, lief mit klopfendem Bauch vergeblich hinter wiegenden Hüften und wippenden Brüsten her und ist in der Nacht auf dem Leib einer leidenschaftlichen Frau fünfmal gekommen - aber er hat, wie wir anderen, wenn es ihm denn wirklich begegnet sein sollte, dies für sich behalten und nicht zum Stift gegriffen und alles niedergeschrieben oder, wie CS, angemerkt, daß ihm dies alles leider wieder einmal nicht gelungen sei. Daß Schmitt derlei umfänglich (für sich!! anders als etwa Ernst Jünger oder Thomas Mann, sowie alle jene, die bei jeder Tagebuchnotiz schon auf den Verlagsvertrag schielen) notiert hat, macht ihn wohl auffällig - aber ihn deshalb (!) für pubertär und erotoman zu erklären, wirkte auf uns komisch.
Das Auffallendste war (vielleicht) - jedenfalls für einen Juristen - wie wenig von seinem Fach die Rede ist. Ausgedehnte Notizen über literarische Funde, über Lektüren aus aller Herren Länder und Zeiten, Verse, Wortspiele, Einfälle, Lesefrüchte en masse, aber kaum ein Wort über die Fachliteratur, die er zweifellos gelesen hat, keine Bemerkung zu Aufsätzen und Büchern juristischer Freunde und Feinde - und das zu einer Zeit, wo der Grund für die meisten seiner heute noch debattierten Schriften gelegt worden sein muss. „Man fragt sich wirklich, wann er gearbeitet hat“ bemerkte Spindler (auch mit Blick auf das bekanntlich nicht sehr seitenstarke, aber endlos durchdachte Oeuvre), als er nicht nur die zeitraubende Tagebuchschreiberei, sondern auch die scheinbar lückenlose Abfolge von Verabredungen, Besuchen, Vorträgen, Abenteuern und (nichtjuristischen) Lesestunden resümierte.
Das Leben als lesender und schriftstellender Jurist, das sieht man bei diesem Befund deutlich, war offenbar auf einen kleinen, schon fast mickrigen Sektor im Alltag des politischen Intellektuellen Carl Schmitt begrenzt, ein Umstand, der freilich die enorme Wirkung dieser schmalen Potenz umso bemerkenswerter macht.
Natürlich fehlte es nicht an der Stimme einer Lady, die davor warnte, das Erstaunliche ins Bewundernswerte umzukippen. Aber die Gemeinde war gerüstet und lächelte nachsichtig. Das Lächeln besagte: wir sind nicht hier, um den Schatten zu tilgen, sondern um ihn, ohne ihn zu beschwören, besser zu verstehen.
Ob dazu viel beigetragen wurde, mag dahinstehen. Wolfram Pyta („Genialischer Vollstrecker“ - Carl Schmitts Deutung von Adolf Hitler) tastete sich jedenfalls am weitesten vor. Mit seinen umsichtigen Ausführungen zum Geniebegriff und seiner These, daß Schmitt im lediglich zweimal gesehenen Führer das (nicht nur von ihm, vgl. Faust, Studierzimmer!) verehrte „Genie der Tat“ erblickt habe, evozierte er gleichwohl lautlos „Der Führer schützt das Recht“ (DJZ 1934, 945 ff.), und der Schatten zog auf. 
Auf dem Heimweg lasen wir uns vor, wie die Nase zum Riechorgan wurde.
Drei Kapitelchen, schlecht organisiert, voller Widersprüche und Redundanzen. Seltsame Archaismen (Aszese statt Askese: 35,36,54), Solözismen („geronn“ statt „gerann“ von „gerinnen“: 46,55), massenhaft Überflüssiges und Nutzloses über die Bade- und Tanzsitten unserer Vorfahren, armseliges name-dropping, mühselig gewunden um die „Geschichte der Nase als Geschichte ihrer Wahrnehmung“ (19) und in die wahrhaft erschütternde These mündend: „Die Geschichte der Nase verweist auf die Geschichte der Wechselwirkungen zwischen Körper und Umwelt, sowie auf die Geschichte der Gesellschaft insgesamt“ (66).
Im besten Fall wurde ein dürftiger Zettelkasten unbesehen ausgekippt, eher ein unverschämtes Machwerk zu einem durch nichts zu rechtfertigenden Preis. Vor Ankauf und Lektüre wird gewarnt. Vor dem Verlag ebenfalls - denn so etwas kann kein Zufall sein.