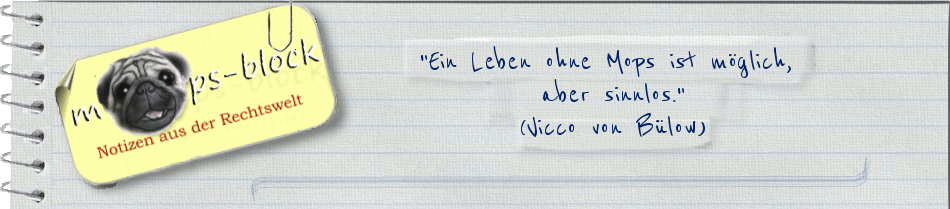Am 15.Mai 2013 fand das lang erwartete und herbeigewünschte Rigorosum, d.h. die Verteidigung der Dr.-Thesen des Stephan Rübben durch diesen in der Humboldt-Universität zu Berlin statt.
Er hielt den ortsüblichen 20minütigen Vortrag und löste eine, von einer einzelnen Zuhörerin aufmerksam verfolgte, engagierte Diskussion unter den Prüfern (Marxen, Simon, Will) aus, welche - durch das einführende exercitium logicum zunächst etwas irritiert - schließlich immer interessierter den Darlegungen folgten und schließlich der einhellig mit summa cum laude ausgezeichneten Arbeit ein alsbaldiges Erscheinen im Druck wünschten.
Der Kurzvortrag ging so:
Was ist ein Tag?
Was ist ein Tag? Mit dieser Frage musste sich kürzlich das Oberlandesgericht Köln beschäftigen. Genauer ging es um die Frage, wie viele Nächte sieben Tage haben.[1]
Es scheint naheliegend zu sagen, dass sieben Tage auch sieben Nächte haben. Dies deshalb, weil ein Tag 24 Stunden dauert und daher auch die Nacht umfasst. Oder, um es etwas philosophischer zu sagen, ein Tag ist die Einheit aus Tag und Nacht.
Ähnlich hatte wohl auch der Kläger gedacht, ein Reiseveranstalter, der einen anderen Reiseveranstalter des unlauteren Wettbewerbs zieh und auf Unterlassung klagte, weil dieser eine Reise, die nur sechs Übernachtungen beinhaltete, als siebentägige Reise beworben hatte.
Stellt man sich auf den Standpunkt, dass 1 Tag 24 Stunden umfasst, dann fehlt sicherlich eine Übernachtung, damit der Beklagte dem Werbeversprechen gerecht wird.
Das OLG Köln sah dies anders. Es liege auf der Hand, sagte es, dass 1 Tag nicht notwendigerweise eine Nacht umfasse. Anreise- und Abreisetag seien als vollständige Tage zu werten. Ähnliches gilt wohl seit jeher im Arbeitsrecht, worauf das OLG Köln jedoch nicht eigens eingegangen ist. Überhaupt schiebt das OLG Köln die für jeden Freund von Rechtstheorie und Methodenlehre doch überaus schöne Frage, was ein Tag ist, überaus schnell beiseite.
Ich denke, das Ergebnis des OLG Köln ist durchaus sinnvoll - aber ist es auch richtig?
Um heraus zu finden, was richtig oder wahr ist, kennt die Rechtswissenschaft von alters her im Wesentlichen ein Werkzeug, den Justitzsyllogismus. Dies ist ein Schluss der Form
(1) a →b
(2) a
(3) b
Dies liest sich so:
(1) Wenn a (wahr ist), dann ist auch b (wahr)
(2) a (ist wahr)
(3) also ist auch b (wahr)
Die Frage, ob unlauter geworben wurde, ließe sich dementsprechend – drastisch verkürzt – so darstellen:
(1) Es ist unlauter zu behaupten, eine Reise habe sieben Tage, wenn sie nur sechs Tage hat.
(2) Die Reise hat sechs Nächte.
(3) Jeder Tag hat eine Nacht.
(4) (daraus folgt:) Sieben Tage haben auch sieben Nächte
(5) Daher ist die Behauptung unlauter.
Woher nimmt man, oder ein Richter, das Wissen um Prämisse (3), dass der Tag eine Nacht hat – oder, im Falle des OLG Köln, das Wissen, dass nicht jeder Tag unbedingt eine Nacht braucht?
Die spärlichen Einlassungen des OLG Köln und die Lehre vom Justizsyllogismus helfen an dieser Stelle nicht weiter. Es scheint, das man einen Syllogismus etwa dergestalt bräuchte: „«Ein Tag hat eine Nacht» ist dann wahr, wenn ein Tag eine Nacht hat“. Hier scheint das Ableiten aber an ein Ende gekommen zu sein.
Das OLG Köln geht einen anderen Weg. Es kümmert sich überhaupt nicht um die Frage und gibt so zugleich eine Antwort, oder zumindest einen Hinweis, wie es weiter gehen könnte.
Offensichtlich ist klar, liegt auf der Hand oder, wie das OLG sagt, erwartet der „durchschnittlich informierte und verständige Verbraucher bei dem Angebot einer siebentägigen Reise nicht, dass diese tatsächlich sieben Tage (7 x 24 Std.) dauert“.
Warum ist das so? Es ist offensichtlich allgemeine Erwartung, allgemeiner Sprachgebrauch.
Die Entscheidung wirkt, so dargestellt, vielleicht etwas autoritär und dennoch reiht sie sich in eine langjährige Tradition der juristischen Methodenlehre ein. Es bedurfte gut 150 Jahre rechtsmethodologischer Begriffsbildung, bis klar wurde, dass der erste Schritt jeder methodologischen Reflektion, nämlich die Bestimmung der Wortbedeutung nicht selbstverständlich ist, sondern DAS kardinale Problem der juristischen Methodenlehre ist.
Insbesondere zwei Schulen (oder Gruppierungen) haben sich damit hervor getan, dieses Problem nicht bloß deutlich zu machen, sondern auch zu bearbeiten:
1) die strukturierende Rechtslehre (insbesondere Friedrich Müller und Ralph Christensen) und
2) das nachpositivistische Rechtsdenken (Alexander Somek und Nicolas Forgó)
Beiden "Schulen" ist gemeinsam, dass sie das traditionelle Verständnis der Gesetzesbedeutung oder allgemeiner der Wortlautbedeutung gewissermaßen umkehren.
Beide gehen sie davon aus, dass Bedeutung nicht in der Sprache oder gar im Wort steckt, sondern dass Bedeutung durch die Sprache erst erzeugt wird.
Damit wird die klassische Vorstellung der Rechtsprechung, wonach der Richter Gesetze „anwendet“ massiv verkompliziert.
Wie soll man etwas anwenden, was man selbst erst durch das Sprechen, das Rechtsprechen, erzeugt? Und, wie wäre dann Gesetzesbindung denkbar?
Um zu diesem Dilemma, oder produktiv formuliert, zu diesem Paradox zu gelangen, bemühen nachpositivistisches Rechtsdenken und strukturierende Rechtslehre alle möglichen Gegenwartsphilosophien von der analytischen Philosophie der Sprache über Medientheorien und Systemtheorie bis hin zur Dekonstruktion.
Vom Aufbau ähneln sich die verschiedenen Werke oftmals sehr. Ausgangspunkt ist fast immer der (späte) Wittgenstein der philosophischen Untersuchungen. Dann werden in der Regel die Wegbereiter des eigenen Ansatzes bemüht (Vaihinger, de Man, Peirce u.v.a.), die einer kritischen Re-Lektüre unterzogen werden, bis hin zu den Helden der Gegenwartsphilosophie: Derrida, Davidson, Brandom.
Wittgenstein hat zwei Begriffe geprägt, die in diesem Kontext besonders interessieren: Regelfolgen und Lebensform.
Hinsichtlich des Regelfolgens hat er gezeigt, dass das Verstehen einer Sprache nicht durch Regeln, die der Sprache zugrunde liegen, determiniert ist. Verstehen, so sagt er, gelingt vielmehr durch die Teilnahme an bestimmten Spielen, die in eine Lebensform eingebettet sind.
Diesen fundamentalen Gedanken hat Brandom noch einmal umfassend ausgebaut.
Davidson verfährt etwas anders. Sein Modell ist das eines Forschers, der eine indigene Sprache erforschen will. Dabei gerät der Forscher in die Situation, dass er mit einem Eingeborenen vor einem hoppelnden Hasen steht, während der Eingeborene „gavagai“ sagt. Davidson versucht nun nachzuzeichnen, was der Forscher tun muss, um den Eingeborenen zu verstehen.
Sein Fazit: Er muss herausfinden, unter welchen Bedingungen seine Hypothese, dass gavagai „Hase“ bedeutet, wahr ist. Dies führt zu einem pragmatischen, theoretisch allerdings recht komplizierten Programm. Im Ergebnis kann man festhalten, dass Verstehen nicht aufgrund von Bedeutung gelingt. Dabei zerstört er viele Ideen, wonach Bedeutung aus der Objektwelt oder aus den Strukturen der Sprache entspringt. Es sei umgekehrt so, dass Bedeutung ein Effekt der Verständigung ist. Erst wenn Äußerungen (lautlich, sprachlich oder auch schriftlich) soweit bearbeitet sind, dass sie verstanden werden, liege auch Bedeutung vor. Diese Struktur sei allem Verstehen gemein, gleich ob es sich um ein alltagssprachliches, umgangssprachliches oder spezialsprachliches Verstehen handele.
Auch wenn den Anhängern der Theorien von Spezialsemantiken (Relativisten) einzuräumen ist, dass die konkreten Bedeutungserzeugungsvorgänge andere Gegenstände, Gepflogenheiten, Kontexte und dergleichen haben, so scheint es dennoch so, als ob Kontexte und Kulturen oder verschiedene Sprachspiele im Prinzip verstanden werden können. Man kann sie also in seine eigene Sprache übersetzen.
Das Verstehen folgt also einer einheitlichen „Struktur“, es ist Effekt einer sozialen Verständigungspraxis.
Dies führt zurück zu den erwähnten neueren Rechtstheorien, insbesondere zum nachpositivistischen Rechtsdenken und zur strukturierenden Rechtslehre. Beide folgen – wie bereits erwähnt – den eben angerissenen Entwicklungen in der Sprachphilosophie. Auch sind sie der Auffassung, dass Verstehen nie im luftleeren Raum, beispielsweise eines logischen Kalküls, stattfindet, sondern wesentlich sozial ist.
Verstanden wird, um es wieder mit Wittgenstein zu sagen, in einer Lebensform. Auch Davidson sucht nach den Bedingungen dafür, dass ein Satz wahr ist und dabei greift auch er auf das Soziale zurück. Während Wittgenstein sich hinsichtlich dieser Frage sehr bedeckt hielt, schmücken Davidson und Brandom das Soziale ganz überwiegend als face-to-face Interaktion aus.
Bei einer solchen Interaktionsform wollen und können moderne Rechtstheoretiker freilich nicht stehen bleiben. Es muss ein Schritt weiter und tiefer hinein in die ausdifferenzierte Welt unternommen werden. Mit diesem Schritt unternehmen sie jedoch zugleich eine etwas eigentümliche Wende. Sie versuchen nämlich nicht nur nach dem Sozialen bzw. nach dem Recht zu fragen, sondern wollen zugleich das eingangs beschriebene Dilemma lösen, wonach der Richter das Recht, an das er gebunden ist, erst selbst erzeugt.
Dazu machen beide Schulen eine ähnliche Bewegung: sie fliehen in den rechts- bzw. verfassungstheoretischen Diskurs. Die strukturierende Rechtslehre findet in diesem Diskurs einen Rettungspunkt in Form von methodenbezogenen Normen. Das nachpositivistische Rechtsdenken findet dort die Legitimation.
Methodenbezogene Normen sollen diejenigen (Verfassungs-)Normen sein, die die Auslegungs- bzw. besser gesagt, die Rechtserzeugungsarbeit strukturieren und führen können. Das Problem dabei liegt natürlich auf der Hand: Wer erzeugt die methodenbezogenen Normen? Das grundlegende Paradox wird nur auf eine andere Stufe gehoben, man könnte auch von einem Zirkel sprechen. Mit den methodenbezogenen Normen wird im Ergebnis versucht, ein bestimmtes Rechts- und Verfassungsverständnis in die Normerzeugung zu implementieren.
Ähnlich wird im nachpositivistischen Rechtsdenken argumentiert. Somek entwickelt dazu allerdings keine Methodik Er versucht stattdessen den normativen Kern des Rechts aufzuspüren, indem er begriffliche Defizite aufzeigt und nach deren Voraussetzungen fragt. Am Ende einer langen Reise gelangt er dann zu einer Ebene, auf der sich das Rechtssystem an und für sich selbst hat – früher war das wohl die im Staate aufgehobene Sittlichkeit, heute könnte man es Legitimation nennen. Merkwürdigerweise sieht diese Legitimation einer Verfassungstheorie nach Rawls-Habermas zum Verwechseln ähnlich.
Diese Gedanken sind in zweierlei Hinsicht sehr problematisch: Zum einen scheint hier der „blinde Fleck“ des Verstehens sehend gemacht zu werden. Das Paradox der Bedeutung wird aufgehoben, indem man versucht, Topoi, Argumente und Regeln zweiter Ordnung heran zu ziehen, die die Rechtserzeugung leiten könnten.
Zum anderen werden die tatsächlichen Lebensformen, in denen Rechtserzeugung stattfindet gegen eine ideale Selbstbeschreibung ausgetauscht. Man könnte versuchen, etwa bei Marx, Luhmann oder Derrida nach Ansätzen zu suchen, die das Soziale der Interpretation erhellen.
Denn Marx und Luhmann und Derrida haben, jeder auf seine Art, versucht zu zeigen, wie Sprache und Gesellschaft zusammen hängen könnten. Vor allem haben sie die bürgerliche Gesellschaft als einen Möglichkeitsraum betrachtet, anstatt sie mit einer idealen Verfassungsinterpretation zu identifizieren und zu verdinglichen.
Was wissen wir also am Ende darüber, was 1 Tag ist?
Nichts.
Daher lag das OLG Köln auch nicht ganz falsch dabei, sich mit dieser Frage gar nicht erst lange aufzuhalten, sondern sie einfach zu entscheiden. Auch wenn etwas mehr Gründe, auch für den unterlegenen Kläger, beziehungsweise dessen Vertreter, sicherlich schön gewesen wären.
Eine Methodenreflexion hätte gewiß nicht weiter geführt. Ist sie deshalb überflüssig?
Ich denke nicht, sie ist ein optimaler Ort, um das Selbstverständnis und die Selbstaufklärung der Rechtswissenschaft voran zu treiben, auch wenn nicht zu erwarten ist, dass es jemals zu einer letztbegründeten Einheitswissenschaft aus Methodenlehre und Rechtstheorie kommen wird.
Stephan Rübben
[1] OLG Köln, Beschluss vom 22.1.13 – 6 W 17/13.
mops-block
Rübben III
- Details