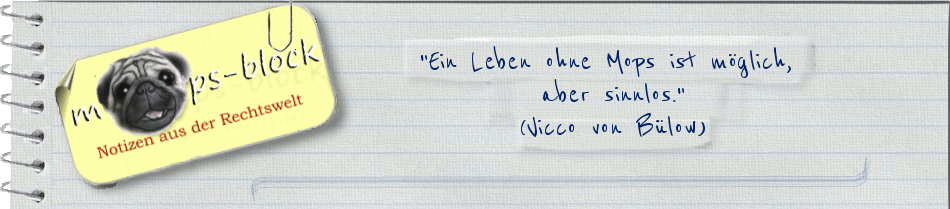Alle reden von München und seinen Richtern. Ich auch. Im hessischen Rundfunk, mit den Studenten, auf der Straße. Wo man hinkommt und als Jurist erkannt wird, stehen einem Fragen nach den Regeln der Platzvergabe im Münchner NSU-Prozess bevor.
Ich rede und erkläre. Daß gegen ein Verfahren nach dem Windhundprinzip prinzipiell nichts einzuwenden sei. Daß ich nicht glaube, daß die Richter etwas gegen die Türken hätten. Daß ich nicht glaube, daß die Richter das Licht der Öffentlichkeit oder die Presse scheuen würden. Daß ich nicht glaube, daß türkische Volksvertreter im Gericht sitzen müssten, um aufzupassen, wozu sie zu Hause mehr Anlass hätten. Dass ich nicht glaube, daß bayerische Richter von Natur aus dumm seien. Daß ich wohl glaube, daß die Münchener Richter arg borniert seien. Daß ich auch glaube, daß der Makel der Beschränktheit nicht bloß in München anzutreffen sei und so weiter und so fort.
Wozu ich meistens nicht mehr komme, ist die Bitte um ein wenig Nachsicht für die armen Münchner. Das muss nachgeholt werden. Schließlich sind sie zwar Täter, aber auch Opfer. Opfer ihrer Schulung, Opfer der Juristenausbildung. Da wird Ihnen der Geist nach wie vor massiv eingeschnürt und - statt ihn zu kitzeln und zu verwöhnen - ausgetrieben. Riesenhafte Stoffmeere, Präjudiziengebirge, Meinungswüsten und Subsumtionssümpfe müssen durchschifft, durchgraben, durchwandert, durchwatet werden bis die Umrisse des vollkommenen Fall-Lösers (und natürlich auch die der keineswegs besseren Fall-Löserin) sichtbar werden. Für Philosophie, Geschichte, Soziologie bleiben keine Zeit und hinterher – das heißt nach dem schweißzitternd überstandenen Examen – keine Lust.
Wäre das anders, hätte man in München nicht bloß stolz davon gefaselt, daß man vor einem „Jahrhundertprozess“ stehe, sondern auch überlegt, was das im Einzelnen bedeutet. Hätte also Folgenreflexion betrieben – eine Übung, die unter den vielen „Übungen“ für Anfänger und Fortgeschrittene im juristischen Studium fehlt. Dann hätte man bedacht, was man immerhin bemerkt hat, daß man mit erheblicher öffentlicher Aufmerksamkeit zu rechnen habe, wozu man also die entsprechenden Räumlichkeiten benötigte.
Gefragt waren also zunächst Verfahrensplanung und Verfahrensorganisation, was aber leider an juristischen Fakultäten nicht gelehrt wird, so daß man sich bald damit abfand („Die Macht der Verhältnisse“) , daß man keinen Raum hatte, der groß genug war, und der Gedanke, daß man dann eben 2 oder 3 Räume nehmen könne oder müsse, wurde mit der abenteuerlichen, aber juristisch einleuchtenden „Überlegung“ abgewiesen, man wolle keine Verfahrensfehler begehen, die eine Anfechtung des Urteils erlauben würden – gerade so, als sei es auch nur denkbar, daß bei einem derart komplexen Verfahren ohne Regelverstoß prozediert werden könne. Die ätzende Effektivität der Erpressung durch „Dienst nach Vorschrift“ verdankt sich bekanntlich dem Umstand, daß die perfekte Befolgung perfekter Regeln den Dienst zum Erliegen bringt. Der „Dienst“ lebt von einer maßvollen Verachtung seiner Regeln. Das weiß man aus der Soziologie der Verwaltung, aber die wird an juristischen Fakultäten nicht gelehrt.
Nun hatte man also einen zu kleinen Raum und deswegen zu wenig Plätze und da empfiehlt sich die gute, alte – auch allen einkaufenden Hausfrauen als gerecht geläufige – Verteilungsmanier nach dem „Windhundprinzip“. Da kann es dann eben passieren, wie heute an der Theaterkasse und vor siebzig Jahren beim Milchmann, daß dann, wenn man in der Schlange endlich am Ziel angekommen ist, der Schalter geschlossen und „nix mehr da“ gerufen wird. Das ist traurig, aber gerecht. Gerecht freilich nur dann, wenn alle eine adäquate Chance zum Mitmachen haben – also z.B. dann, wenn alle den Zeitpunkt gleichzeitig erfahren und nicht manche schon früher „wegen technischer Pannen“ (hihi) und andere erst in der Nacht (wegen der Zeitverschiebung) usw. Außerdem muss man erwägen, daß vielleicht besondere Interessen bestehen, die es gerechtfertigt erscheinen lassen könnten, manche vom Windhundverfahren auszunehmen und ihnen Plätze zu reservieren. Angehörige vermutlich, aber auch angesichts acht ermordeter Türken hoffentlich der türkische Staat, sicher aber doch die türkischen Medien, denen man geradezu einen moralischen Anspruch zubilligen könnte, an der heiligen Öffentlichkeit beteiligt zu werden.
Aber dazu bedarf man der politischen Bildung und der sozialen Sensibilität und der Kenntnis von der medialen Welt und ihren Bedingungen – aber all das sieht der Rechtsunterricht nicht vor. Meldet sich doch sogar im Deutschlandfunk ein gut ausgebildeter juristischer Holzkopf und trägt lamentierend seinen Abscheu über die Entrüstung vor, die allenthalben die Münchener Borniertheit anprangert, wobei die guten Richter doch nur zu prüfen haben würden, ob die Mordmerkmale des § 211 StGB erfüllt seien, wo aber von Staatsangehörigkeit offenkundig nichts stehe.
Genau! Was dort nicht steht, kann man nicht lesen und was man nicht lesen kann, sieht man nicht und was man nicht sieht, spielt keine Rolle. Das ist das Lebensmotto des Subsumtionsidioten.
Also fällt das Kind in den Brunnen und da liegt es nun. Rücktrittsangebote der glücklichen Windhunde zugunsten derer, die gar nicht erst gestartet sind, werden abgelehnt mit der schlauen Begründung, die nichtbegünstigten Nichtstarter könnten dann vielleicht klagen. Könnten! – vielleicht. Aber würden sie auch? Eine Frage der Psychologie und der sozialen Empirie. Ja , wenn man davon etwas verstünde oder wenigstens wüsste.
Aber nichts von alledem haben die bedauernswerten Münchener gelernt und das liegt nicht daran, daß die Bayern prinzipiell lernunfähig wären (sind sie nicht, wie immer wieder einmal durchsickert), sondern daß man ihnen die richtige Lehre nicht angeboten hat. Die Juristenausbildung residiert mit ihren Staatsexamina, ihrer theorienverkleideten Meinungsseligkeit und ihrer Auslegungsideologie immer noch im Obrigkeitsstaat.
Aber das Bundesverfassungsgericht hat doch wieder einmal alles richtig gemacht, könnte man sagen, hat doch angeordnet, daß Plätze zu schaffen sind und den Richtern erklärt, was denen nicht bekannt war, daß sie nicht nur Unabhängigkeit besitzen als Abwehrrecht, sondern auch Gestaltungsfreiheit als Möglichkeit zum Handeln. Weshalb sie jetzt vielleicht noch einmal von vorn beginnen werden mit ihrer Saalsuche oder dem Akkreditierungsspiel oder mit was auch immer, und ihren Prozess bereits auf den 6. Mai verschoben haben. Diese Verfassungsrichter aber sind doch auch Richter – bessere vielleicht als die am Oberlandesgericht in München, aber auch solche, die der Juristenausbildung ausgesetzt waren, so daß die Münchener schließlich doch nicht zu bedauern, sondern, wie es nun generell geschieht, zu tadeln wären.
Aber das wäre nicht gerecht. Die Verfassungsrichter sind eben (anders als die OLG-Richter) nicht bloß solche, die die Juristenausbildung genossen haben – sie sind ausnahmslos irgendwie auch politisch trainiert, politisch tätig, politisch aufgefallen, politisch gebildet und gebunden gewesen – sonst wären sie niemals von Politikern gewählt worden. Das ist der akademisch nicht vermittelte Mehrwert, der dem OLG fehlt.
Es darf also bei Mitleid – und Besorgnis bleiben.
Besorgnis? Wie soll man hoffen können, daß ein schon im Vorzimmer des Rechts derart mit Patzern und Fehlern belastetes Verfahren halbwegs ordentlich durchgeführt werden kann? Was steht zu erwarten, wenn irgendetwas nicht Vorbedachtes und Vorbedenkbares geschehen würde?
Nicht auszudenken, was geschähe, wenn etwa die bislang stumme, aber vermutlich von sehr vielen Seiten sorgfältig bearbeitete Frau Zschäpe den Subsumtionsartisten und border-line-case-Denkern lächelnd eröffnen würde, sie sei eine ordentliche Informantin des Verfassungsschutzes und verlange ordentliche Behandlung?
Sie würden aus ihrem Verfahren purzeln, wie die leeren Büchsen am Wurfstand einer Kirmes.
mops-block
Juristenausbildung
- Details