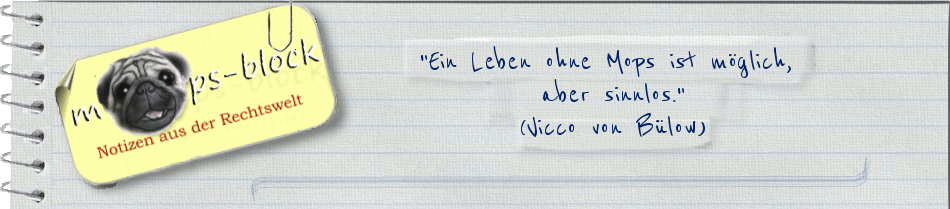Selbstplagiat! Zunächst hielt ich den Ausdruck für einen Neologismus. Erfunden von einem jener Saubermänner oder besser Schmutzmänner im blütenweißen Tarnkostüm der reinen Wissenschaft, die neuestens vielerlei - am liebsten aber politischer - Prominenz nachstellen.
Eine kleine Recherche hat mich aber schnell eines Besseren belehrt.
Schon vor mehr als 60 Jahren, am 5. Okt. 1962, taucht der Begriff in einem Artikel des Schriftstellers und Kritikers Robert Neumann (1897-1975) in der ZEIT auf (Kitsch as Kitsch can). Vielleicht stammt er von ihm. Jedenfalls kommt er im ZEIT-Corpus des DWDS, das immerhin bis 1946 zurückreicht, nicht früher vor und zuzutrauen wäre er dem Sprachkünstler jedenfalls. Aber das mag dahinstehen. Ich habe mich, da Genaueres hier irrelevant ist, auf das großartige ZEIT-Archiv beschränkt. Denn jedenfalls ist das Selbstplagiat keine Schmutzmänner- (vulgo: „Plagiatsjäger“-) Erfindung, die man versucht sein könnte, mit einem schnellen „Hoho, wer kann sich denn selbst bestehlen?“ beiseite zu wischen. Denn jene Subspezies des homo sapiens sapiens stupidus war seinerzeit noch nicht in Sicht.
„Ich kann dem Selbstplagiat nicht entfliehen“ ruft Neumann in komischer Verzweiflung aus, als er sich vorgeblich vergeblich bemüht, seine köstliche Anekdote aus Komotau („Provinzstadt in Mähren“) zu zitieren, ohne sie erneut zu erzählen. Worauf er sie dann, trotz des trotzigen „ich kann mich nicht noch einmal abschreiben, ich schreibe mich ohnedies zu oft ab“, erneut erzählt.
Fünf Jahre später, am 7. April 1967, rezensiert Dieter E. Zimmer in der ZEIT den Einhundert Dollar Mißverständnis-Autor Robert Gover und berichtet, daß dieser an den Erfolg seines ersten Romans anknüpfen wollte und ihm eine Fortsetzung geschrieben habe. Jedoch: „Es ist ihm nicht mehr gelungen als ein Selbstplagiat“. Was soll das heißen? Hat er, wie nach der Verwendungsweise des Ausdrucks durch Neumann zu vermuten gewesen wäre, dieselbe Geschichte ohne einschneidende Änderungen ein zweites Mal erzählt? Nein. „Die Methode ist die gleiche“, sagt Zimmer, nämlich der Einfall, dieselben Ereignisse aus der Perspektive zweier verschiedener Personen einmal so und einmal anders erzählen zu lassen, so daß dem Leser gleichsam dialektisch eine komplexe Sicht der Geschehnisse geboten wird.
Die Verwendung der gleichen Methode als ein Fall von reflexivem Ideenraub - zweifellos ein kühner Gebrauch des Begriffs, um zu geißeln, was der Kritiker vermisst: eine neu-ursprüngliche, eine originelle Idee im Einsatz am Material. Aber insofern geht dieser Wortgebrauch dann doch noch mit Neumann konform, als der Vorwurf den Mangel an Kreativität treffen soll, die Iteration als Zeichen künstlerischer Ermattung, die Selbstwiederholung des Artisten, dem nichts mehr einfällt. So daß er sich bei sich selbst bedient.
Dabei ist es dann geblieben. Ein Franz Schöler kann im ZEIT-Archiv besichtigt werden, wie er (15.9. 1972; 6.12.1974) John Lennon im „kreativen Vakuum“ ertappt und dessen damals jüngste Produkte geißelt, denn der Musiker „plagiiert auf miserable Weise seine früheren Kompositionen“ und sein Album präsentiert sich „als dünner Aufguss melodischer Ideen, die er letztlich schon bis zum Überdruss plagiiert hatte“, wobei die Neuerscheinung nur „das Unerträglichste seiner Selbstplagiate“ darstellt. Und Martin Gregor-Dellin (1926-1988 - laut Wikipedia: „ein deutscher Schriftsteller“) bescheinigt Siegfried Lenz am 12.9. 1975 daß es bei ihm zwar „scheinbar thematische Wiederholungen“ gäbe, „die sich jedoch als ganze neue Versionen entpuppen und in nichts den Verdacht eines Selbstplagiats wecken“.
Erst in jüngster Zeit scheint sich ein gewisser Trend zur Diskriminierung nicht bloß der thematischen oder methodischen Idee, sondern auch des bis auf den molekularen Satz hinunter verfolgten Selbstzitats abzuzeichnen. Jedenfalls darf man Evelyn Finger (ZEIT-Online 16/2001) wohl so verstehen, die gelegentlich des Urheberstreits zweier Schreiberinnen betreffend die Wendung „herabhängender Schnauzbart“ vor den Folgen eines ungebändigten „Originalitätswahns“ warnt. Denn unter Hinweis auf Publius Terentius Afer (161 v. Chr., Eunuchen, Prolog: denique nullumst iam dictum quod non dictum sit prius - schließlich gibt es nichts Gesagtes, das nicht bereits gesagt worden wäre) bemerkt sie, daß im Falle, daß „jedes literarische Motiv zu seinem Ausgangspunkt zurückverfolgt“ würde, „wir unsere Bibliothek auf dreieinhalb Bücher zusammenschreddern“ könnten. Und bei Rückgang auf den einzelnen Satz blieben im Sinne von Terenz nicht einmal diese übrig.
Das ist freilich gerade das, was sich die Fahnder im Reiche der Wissenschaft wünschen. Wobei sie beim „Schreddern“ weniger an ihre eigene Bibliothek als an die mit Missfallen beobachtete politische Karriere des „Selbstplagiators“ denken.
Denn in der Wissenschaft gelten selbstverständlich andere Regeln als in der Kunst. Der ästhetische Tadel mag schmerzen und verletzen. Aber der von ihm Getroffene steht lediglich wegen Impotenz, nicht wegen Betrugs am Pranger. Wer sich jedoch im Bereich des reinen Denkens unoriginell bei sich selbst bedient, gilt nicht als einfallslos oder erloschen, dessen Bemühungen man ablehnt oder mit schlechten Noten verziert, sondern als Betrüger, der es versäumt hat, seine alten Sätze zu nummerieren und jede Wiederverwendung mit einer Fußnote zu markieren. Früher haben wir über jene gelacht, die in langen Fußnotenketten immer wieder zu sich selbst bemerkten: „so schon richtig Fritz Müller 1962“; wir haben es für selbstverständlich gehalten, daß ein erster Versuch zu Besserem und Richtigem ausgebaut werden durfte - die Seminararbeit zur Studienarbeit, der Magistertext zur Dissertation! Und wir haben Kollegen belächelt, die unermüdlich denselben kleinen Einfall mit neuem Titel und in neuer Sprache anboten, um nicht mit einem allzu dürftigen Literaturverzeichnis sterben zu müssen.
Jetzt herrschen andere Verhältnisse. Wer seine Botschaften wiederholt wie der Pfaffe auf der Kanzel oder der Politiker im Interview, der muß sich also vorsehen. Jeder sein eigener Historiker und Buchhalter. Harte Zeiten für Missionare und andere Bekenner: wie ich kürzlich, gestern, vorgestern, am 1.Mai 2005 etc. bereits sagte,schrieb usw. werden die Einleitungsformeln der Zukunft sein.
Keine Frage, warum das so gekommen ist. Guttenberg hat die Preise verdorben. Daß es gelungen ist, einen politischen Popstar durch den Nachweis des Plagiats von der Bühne zu stürzen, hat den wissenschaftlichen Betrug zur politischen Waffe umgeschmolzen.
Wogegen prinzipiell nichts einzuwenden ist, wenngleich es dem Beobachter nicht gefallen kann, daß die Waffe sich dort, wo sie in erster Linie eingesetzt werden müsste, nämlich bei der Wissenschaft und den Wissenschaftlern, als merkwürdig stumpf erweist - oder wurde je ein plagiierender Professor bei der Räumung seines Lehrstuhls beobachtet?
Jetzt allerdings beginnt die Revolution mit dem Fressen ihrer Kinder. Waffen vermehren sich durch sich selbst. Durch die selbstbezügliche Wende und die molekulare Zuspitzung (siehe: „herabhängender Schnauzbart“) wird automatisch jeder, der sich wiederholt, zum verderbten Auto-Plagiator.
Das könnte sogar wünschenswerte Folgen haben:
Zum Beispiel starker Rückgang der professoralen schriftstellerischen Tätigkeit. Neue Gedanken sind - jeder hat es leidvoll erfahren - relativ selten. Für die wenigen auch noch ständig ein neues Ornat entwickeln zu müssen, ohne in die autoplagiatorische Falle zu rennen, dürfte schwer werden.
Ferner: Rasches Verschwinden der Qualifikationsarbeiten, die nur darauf abzielen, daß Kandidatinnen und Kandidaten Verständnis zeigen. Großräumige Entlastung der Aufsichtspersonen von Korrekturarbeiten.
Schließlich: Bei absolutem Vorrang und endlichem Triumpf inhaltlicher und formaler Originalität bei jeder wissenschaftlichen Arbeit notwendig breitflächiges Verstummen oder globale Selbststerilisation der Plagiatsjäger.
mops-block
Gutenbergs Erben
- Details