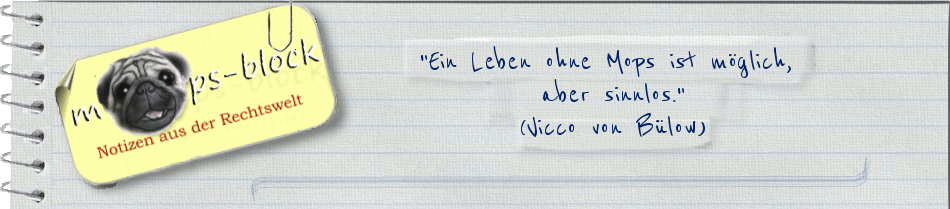Einer Anregung von Rainer Kiesow folgend, habe ich mich der Gutachtentransparenz befleißigt, und mein Erstgutachten an dieser Stelle publik gemacht (Julia Küppers I).Christoph Paulus hat sich angeschlossen und mir seinen Text überlassen (Julia Küppers II). Jetzt hat das Verfahren stattgefunden. Die Prüfungskommission (Marxen, Paulus, Simon) zeigte sich nicht so sehr von den Thesen der Verfasserin überzeugt als von der Radikalität ihrer Neugierde und ihrer kritischen Leidenschaft, Eigenschaften, die nach Meinung der Kommission Ausdruck und Garanten einer zutiefst wissenschaftlichen Haltung sind. Da genau danach aber gefragt werden sollte und die temperamentvolle Diskussion im Anschluss an den Vortrag die Vor-Urteile bestätigte, trug die Kommission keine Bedenken, die Kandidatin umstandslos mit höchstem Lob zu entlassen. Hier folgt, zum guten Ende der Geschichte, die Verteidigungsrede, die vielleicht den einen oder anderen zum Disput mit der Autorin anregen wird.
Die Wahre Wahrheit über die Bodenreform.
Theoretische Betrachtungen rechtsgeschichtswissenschaftlicher Praxis
Verteidigungsrede
von
Julia Küppers
gehalten am 26. Juni 2012
Die Wahre Wahrheit über die Bodenreform ist auch eine Arbeit über das Wundern. Sie ist eine Erzählung von meiner Suche nach Erkenntnis.
I.
Am Anfang der Arbeit wusste ich, dass nach dem 8. Mai 1945 in allen Besatzungszonen noch weitgehend dieselben Normen Gültigkeit hatten, wie zuvor. Außerdem hatte ich gehört, dass jedenfalls in der Sowjetischen Besatzungszone etwas Neues, nämlich ein sozialistisches Gemeinwesen, geschaffen werden sollte. Ein Sozialistisches Gemeinwesen braucht – so meine Vorstellung – ein sozialistisches Wirtschaftsrecht. Und so wollte ich also herausfinden, ob, und wenn ja wie, sich so ein sozialistisches Wirtschaftsrecht an den ostdeutschen Hochschulen entwickelt hatte. Schon hier, während der Vorgeschichte meiner eigentlichen Untersuchung – wunderte ich mich. Mich wunderte, wie trotz Geltung der immergleichen Gesetze ein neuartiges Recht gelehrt werden konnte. Dieses Wundern führte mich nach kurzem Einlesen zu vier, so genannt „grundsätzlichen“ Reformen, die noch 1945 in der Sowjetischen Besatzungszone durchgeführt wurden. Ich hatte die Wiederingangsetzung der Produktion, die Banken-, die Boden- und die Industriereform identifiziert.
Wie der Titel meiner Arbeit verrät, machte ich mich zuerst daran, die Bodenreform zu beschreiben. Und das wollte ich gut machen. Deswegen las ich viel, denn ich dachte, so auch besonders viel über die Bodenreform zu erfahren. Ich las also Vieles des Vielen zur Bodenreform Geschriebenen – und musste mich wieder wundern. Denn je mehr ich las, desto weniger wusste ich. Die nach einem kurzen Einlesen so klar scheinende grundsätzliche Reform verflüchtigte sich, je mehr ich versuchte, mich ihr durch neue Materialien anzunähern. Ich konnte schlicht keine in sich schlüssige Berichterstattung der Bodenreform aufschreiben. Deswegen schrieb ich stattdessen eine unschlüssige, sich in jeder Facette ihrer Darstellung widersprechende, Erzählung von der Bodenreform auf.
II.
Nach getaner Arbeit hielt ich inne – und dachte nach. Dachte insbesondere über die Absichten nach, die die in meinem Geschichtensubstrat vorkommenden Erzähler verfolgten. Als Absicht identifizierte ich den immer noch allgemeingültigen Anspruch der Historiker, DIE über den Einzelgeschichen liegende, kollektivsinguläre Geschichte zu erzählen. Dass eine solche Geschichte ohne Objektbezug, die auch das Einzelne eingebettet in die Weltgeschichte universal so darstellt, wie es sich zugetragen hat, nach wie vor möglich ist, ließ ich mir von Koselleck und Wehler bestätigen. Soweit so gut. Ausgestattet mit diesem theoretischen Wissen ging ich wieder an die Praxis. Ich hatte eine Idee. Möglicherweise ließ sich das zuvor so verwundernde, variantenreich Erzählte nach seinen Erzählern ordnen. Ich hatte die Hoffnung, durch detaillierten Rückgriff auf die Erzähler Regelmäßigkeiten aufzufinden, nach denen sich ein unterschwelliges Substrat als DIE Geschichte der Bodenreform erkennen ließ.
Aus den 267 mir begegneten Erzählern wählte ich also 30 aus. 30 Erzähler, die zwischen 1946 und 2007 aus Ost- und Westdeutschland, England Frankreich und den USA über die Bodenreform geschrieben hatten. Ich ordnete ihre Erzählungen nach drei Merkmalen: warum, von wem und mit welchen Ergebnissen die Reform durchgeführt wurde. Nach dieser Einordnung hatte ich fünfzehn Geschichtenvarianzen identifiziert, die von einem bis vier Erzählern relativ einheitlich erzählt wurden. Allerdings konnte ich keine Rückschlüsse von den Erzählenden auf das Erzählte, oder Regelmäßigkeiten innerhalb der Erzählergruppen entdecken. Erneut saß ich verwundert da – und wendete mich wieder der Theorie zu.
III.
Es galt, herauszufinden, mit welchem Vorgehen Geschichtswissenschaftler ihr Vorhaben, DIE Geschichte zu erzählen, erfüllen wollen. Ich lernte den immer noch gültigen, von Droysen begründeten Dreischritt aus Heuristik, Kritik und Interpretation kennen. Darüber hinaus erfuhr ich, dass die Historiker beim Finden DER Geschichte schon lange von der Notwendigkeit fiktionaler Erkenntnismittel ausgehen. Meine, zugestandenermaßen unbedarfte Herangehensweise, die einfach nur darstellen wollte, wie sich die Bodenreform zugetragen hat, musste ich mir selbst als „fatale Bequemlichkeit des Denkens“ (Oexle, 59) vorhalten lassen. Ich lernte in diesem kurzen Methodenabriss die wohl herrschende Meinung der Geschichtswissenschaft kennen. Nach dieser ist Historische Erkenntnis nicht Abbildung einer äußeren gewesenen Wirklichkeit, sondern Entwurf, Hypothese oder Konstruktion. So zog ich in Erwägung, die Geschichtsschreibungsvielfalt als einen Umstand anzuerkennen, der niemanden mehr ernsthaft beschäftigt. Wobei ich für diese Einsicht nicht einmal die am Horizont aufscheinenden Postmodernisten benötigt hatte.
Doch leider wunderte ich mich weiter, denn die Lesepraxis hatte mir Gegenteiliges vermittelt. Trotz der fiktionalen, Varianzen abstrakt anerkennenden Postulate, konnten sich die Erzähler konkret nicht mit der Vielfalt abfinden. Anders gesagt hatte ich bei jedem von ihnen den Anspruch gefunden, auch im Bewusstsein anderer Erzählweisen nur selbst die einzig richtige Geschichte der Bodenreform zu erzählen. Insbesondere einer bestärkte meine Verwunderung für den Bereich der Bodenreform. Arnd Bauerkämper hatte die vielen Geschichten der Bodenreform, meinen 30 Einzelerzählern ähnlich, beschrieben. Doch Arnd Bauerkämper wunderte sich nicht. Seine nicht vorhandene Verwunderung lag aber nicht an der abgeklärten Anerkennung verschiedener Erzählweisen. Er wundert sich nicht, weil er die verschiedenen Geschichtsvarianten zu bewerten und zu erklären wusste. Er vermochte sie in Generationen einzuordnen, und wusste, welche Bodenreformvariante von der eigentlichen Bodengeschichte abwich. In seiner Lesart wurde die Vielheit zu einer Einheit. Mit dem gerade neu erworbenen Wissen um Fiktionalität in der Geschichtsforschung, verwunderte mich das umso mehr. Und machte mich gleichzeitig neugierig. Wie war ihm das gelungen? Wie konnte er aus den Varianzen DIE Geschichte erkennen?
IV.
Bauerkämpers Erklärung für die Vielfalt in der Geschichtsschreibung ist die Standortbindung des Historikers. Ich lernte, dass die meisten Erzähler ihre Geschichten aus ihrer eigenen Überzeugung und Biographie heraus, und damit am Kern DER Geschichte vorbei erzählen. Eine nicht unplausibel erscheinende Erklärung, die ich nun selbst auf die gelesenen Vielfältigkeiten anwenden wollte. Hierfür besann ich mich auf einen Erzähler, dessen Standort wohl jedem Leser ohne große Überlegungen ins Auge springt. Ich besann mich auf Thomas Gertner. Einen Rechtsanwalt der Personen vertritt, die nach dem 8. Mai 1945 Verfügungsgewalt über Grundstücke verloren haben. Gleichzeitig hat er viel zur Bodenreform geschrieben. Und seine zahlreichen Erzählungen – das konnte ich nach eingehender Betrachtung feststellen – unterliegen einer beeindruckenden Wandelbarkeit. Am Ende der Gertnerschen Geschichtenexegese angekommen, wollte ich mich nicht mehr wundern. Stattdessen versuchte ich, Bauerkämpers Erklärung der Standortbezogenheit auf das soeben Gelesene anzuwenden. Die Erkenntnisse klingen plausibel. Der jeweilige Standort des Anwalts ist durch die Interessen seiner Mandanten bestimmt. Ändert sich die Rechtsprechung, ändert sich auch die Erzählweise von Thomas Gertner. Ich hatte Standortbindung in der Geschichtenerzählung in Reinform kennen gelernt. Allein – was folgte aus dieser Erkenntnis? Wie konnte mich nun die Entlarvung der Standortbindung eines anderen zum Inhalt DER Geschichte führen? Woraus folgte überhaupt, dass die standortgesäuberte Variante das Gegenteil der standortgebundenen Variante ist? Und – noch verwunderlicher – woher sollte ich wissen, dass die Standortsäuberung nicht lediglich durch meinen eigenen Standort bedingt ist?
V.
Auch nach dem Gertner-Lehrstück von Standortbindung in der Praxis wunderte ich mich also weiter. Die Standortbindung allein vermochte die Sicherheit, mit der Bauerkämper – und andere – andere Geschichten als falsch entlarvten, nicht plausibel zu machen. Um herauszufinden, wie es die Historiker schafften, trotz Anerkenntnis der Fiktion und Standortgebundenheit DIE Geschichte der Bodenreform zu erzählen, wendete ich mich also wieder der Theorie zu. Ich suchte nach einem Ursprung für die Standortbindung, und fand ihn bei Chladenius und seinem 1752 vorgestellten Sehepunckt. Hier lernte ich, dass jeder die Sache zu jeder Zeit nach seinem Stande betrachtet. Außerdem, dass auch derselbe Mensch zu „verschiedener Zeit wegen des veränderten Zustandes seiner Seele, die Sache mit ganz anderen Augen ansehen kann“(123). Diesen „Sehepunckt“ kann ein Erzähler nicht verlassen, denn ohne Sehepunckt – vermag er nichts zu sehen. Äußerst plausible Einsichten hatte ich da gefunden. Doch ich musste mich weiter wundern. Denn schon bei Chladenius konnte, trotz nicht zu überwindendem Standort, erkannt werden, wie sich die Sache tatsächlich zugetragen hatte. Der Erkenntnisschlüssel sollte im Anhören besonders vieler Varianzen der Sache liegen, um dann durch „Einsicht in die Regeln historischer Erkenntnis urteilen zu können, wie die Sache innerlich beschaffen gewesen“.
Am Inhalt dieser Handlungsanweisung hatte sich auch 256 Jahre später wenig geändert. Konkret fand ich bei Kocka eine Zauberformel, nach der trotz Sehepunckt – Standortbindung – „wahre Aussagen mit universalem Geltungsanspruch“ möglich bleiben. Die Zauberformel setzt sich aus den Quellen, der Intersubjektiven Kritik und der Objektivität sichernden Methode zusammen. Genauer erfuhr ich, dass der Anspruch der Geschichtswissenschaft im Angesicht verschiedener Erzählvarianzen dahin geht, die Varianzen kritisch miteinander zu verbinden. Historiker sollen sich – in Intersubjektiver Kritik – aneinander abarbeiten. Gleichzeitig sollen und wollen sie den eigenen Standort objektivieren. Und das können sie – so lernte ich – durch die strikte Anwendung von Methode. Wobei „Methode“ an dieser Stelle mehr versprach als der bei Droysen kennen gelernte Dreischritt. Auf jeder Stufe des Dreischritts konnte die Objektivität gesichert werden. In der Heuristik etwa durch Selbstreflexion über die Entstehungsgeschichte der verwendeten Begriffe. In der Kritik etwa dadurch, ausgewertete Akten vor dem Hintergrund der Selbstbildnisse der Machthaber zu lesen. Und im Dritten Schritt – der Interpretation – etwa durch komparative Fallstudien, durch die Verbindung von politik- sozial- und Alltagsgeschichtlichen Aspekten. Mit dieser Erkenntnis war der ohne Methodenreflektion oder intersubjektive Kritik schreibenden Gertner als Lehrstück der Standortbindung ohnehin durchgefallen. Gleichzeitig wurde mir bewusst, dass Arnd Bauerkämper die von der Geschichtswissenschaftlichen Zunft aufgestellten Kriterien in seiner Arbeit vorbildlich verwirklicht hatte. Getreu dem Grundsatz, lieber erzählend die Erzähler zu beobachten, als selbst zu versuchen, die Lehrstücke von Standortbindung und Objektivität anzuwenden, beschloss ich, mit Arnd Bauerkämper in die Tiefe zu gehen.
VI.
Bauerkämper hat zwischen 1994 und 2008 fast vierzig Beiträge und Abhandlungen zur Bodenreform geschrieben. Ich habe alle Geschichten genauestens untersucht. Und am Ende der Untersuchung wunderte ich mich.
Aus der Lektüre Bauerkämpers ergab sich eine ähnliche Geschichtenvielfalt, wie bei unterschiedlichen Erzählern aus verschiedenen Sozialisierungshintergründen. Seine Geschichten waren nicht einmal signifikant einheitlicher als die Erzählungen des ohne jegliche Methodenreflektion schreibenden Thomas Gertner. Bauerkämper formuliert zudem in jeder einzelnen seiner Geschichtenvarianten den Anspruch, die gerade einzig mögliche Geschichte der Bodenreform zu erzählen. Das ist nicht DIE Geschichte der Bodenreform, die verallgemeinerungs- und intersubjektiv anerkennungsfähig über empirisch richtigen Einzelgeschichten steht. Mein bisheriges Wundern wandelte sich so langsam zu Erkenntnis. Ich erahnte, dass Historiker ihrem selbst gestellten Anspruch nicht genügen können – gleichgültig, ob sie nun befähigte oder unfähige Erzähler sind. Methoden lösen sich ab, werden als Methode behauptet, ohne Methode zu sein. Das von Historikern als Methode Bezeichnete ist selbst nur eine Art von Geschichte, die im Vorfeld erdacht als abstraktes Deutungsmuster verkauft wird. Die methodisch ermittelten Kausalitäten sind Zuschreibungen aus der Lebenswelt des Erzählers. Sie können daher keine abstrakt bindende Anleitung zur Rekonstruktion liefern. Die Unendlichkeit der Möglichkeiten zur Verknüpfung liefert die Möglichkeit für unendliche Geschichten. Lehrer dieses Gedankens war für mich Paul Veyne. In deutscherer Denktradition verhaftet findet er sich bei einem anderen Paul, bei Paul Feyerabend.
VII.
Ich war also vom Wunderer durch Beobachtung so langsam zum Erklärer geworden. Als solcher musste ich eingestehen, einen zentralen Faktor historischer Wissenschaftlichkeit bisher stiefmütterlich behandelt zu haben. Ich hatte bei meiner Suche nach DER Geschichte der Bodenreform die Quellen, die empirische Basis, das Gerüst der Historiker, verschwiegen. Und diese versprachen Rettung. Mit Jens Nordalm hatte ich einen Paten für die mögliche Rettung gefunden. Er hält unter Ablehnung des Methodenfetischismus am forschenden Verstehen der Quellen, und damit an der möglichen Abbildung DER Geschichte fest. Im Einklang mit Feyerabend kritisiert er das postuliert „Abstrakte“ der seit Descartes eingeführten Trennung der Methode von ihrem Gegenstand.
Anders als Nordalm hatte Bauerkämper Methode und Intersubjektive Kritik als unabdingbar für richtige historische Erkenntnis postuliert. Vergeblich, wie meine Untersuchung gezeigt hat. Bauerkämper hatte jedoch – im Einklang mit Nordalms Ansatz – jeden seiner Texte, geschichtswissenschaftlich versiert, mit Quellen belegt. Ich fragte mich, ob sich nicht wenigstens mit der Untersuchung der Quellen eine Regelmäßigkeit erkennen ließ. Wohl oder Übel musste ich mich erneut in die Geschichtenexegese begeben. Und obwohl ich durch das viele Wundern bereits zu Schlussfolgerungen gekommen war, wunderte ich mich wieder. Denn Bauerkämpers Texte folgten keiner Quellenmäßig belegbaren Regelmäßigkeit. Der Inhalt der Texterzählung hatte keinen Einfluss auf die von ihm zu Rate gezogenen Erzähler – und umgekehrt. Ich stand vor einem geschichtswissenschaftlichen Scherbenhaufen. Vor dem die Quellen nicht einmal mehr dazu in der Lage waren, als Vetorecht den Forscher vor Irrtümern zu schützen. Meine Beobachtungen hatten mich schließlich zum oft beschriebenen Problemkreis um Fakten und Fiktionen geführt. Ich war in der Postmoderne angekommen – die übrigens auch der Mode unterliegend, mittlerweile veraltet daherkommt.
Meine Beobachtungen hatten mir jedoch gezeigt, dass es vor den Erkenntnissen der Sprachphilosophie, vor der Nicht-Darstellbarkeit des Darstellbaren, der ständigen, kontingenten Bedeutungsverschiebung zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem, kein Entkommen gibt. Das Faktum ist immer nur linguistisch existent. Geschichtsschreibung ist nie direkter Zugang zu einer hinter der Sprache liegenden Realität. Es gibt außertextliche Sachverhalte, aber ich kann sie nicht erfassen. Sobald ich sie erfasse, werden sie – nur – zum Text als Zeichenfolge.
Angesichts dieser Erkenntnisse bleibe ich verwundert zurück. Verwundert darüber, dass die herrschende Geschichtswissenschaft weiterhin fröhlich glaubt, „vergangene Komplexphänomene nicht einfach anders, sondern auch besser zu verstehen, als andere“. Verwundert bin ich darüber, dass sich die geschichtsphilosophische Dimension, also der Glaube an den Fortschritt der Weltgeschichte, in den Bereich der Methode verlagert hat. Trotz der offensichtlichen Unzulänglichkeit glauben Historiker, durch immer bessere Methoden immer genauer erfahren zu können, was sich damals tatsächlich zutrug. Und das in dem Paradox, Rankes Diktum „wie es eigentlich gewesen“, in einheitlicher Manier als erkenntnistheoretisch naiv und überholt zu belächeln. Soviel zu den Beobachtungen.
VIII.
Abschließend will ich noch einige Worte zu meinem Vorgehen sagen. Erstens: Ich habe mich – erkenntnistheoretisch unbekümmert und unbedarft neugierig – um das Wundern gekümmert. Ich habe versucht, wenig zu wissen. Habe versucht, am Rande des Feldes die anderen zu beobachten. Selbiges in dem Wissen, das Feld nicht verlassen zu können. Die Unbedarftheit war – das sage ich bewusst ketzerisch – meine Methode. So habe ich die Erzähler beim Wort genommen. In dem gleichzeitigen, sich immer mehr aufdrängenden Wissen, dass ich die Erzähler „eigentlich“ nicht „beim Wort“ nehmen kann. Denn „beim Wort“ ist immer und immer wieder nur „mein Wort“.
Damit sind wir bei Zweitens angelangt: Würde ich diese Erkenntnisse beim Wort nehmen, hätte ich diese Arbeit nicht schreiben dürfen. Denn auch in dieser Arbeit begebe ich mich auf Bedeutungsstrukturen, wende Wahrheiten an, glaube zu wissen was logisch ist und entlarve andere als falsch. Paradoxerweise habe ich am Ende in der Erkenntnis, dass es Die Wahrheit nicht gibt, selbst eine Wahrheit beschrieben. Dabei habe ich doch gerade herausgefunden, dass es keine Bindung, kein richtig oder falsch gibt. Ich kann nicht negieren, dass ich in Wertstrukturen lebe, Wissenschaftlichkeit anerkenne, und dennoch jederzeit das als Wissenschaftlichkeit Anerkannte widerlegen kann. Allein, es geht nicht anders. Es gilt – mangels Alternativen – das Paradox zu ertragen, und vielleicht die Fragestellung zu ändern.
Womit wir zum Dritten und letzten kommen: Ich habe keine „Moral von der Geschicht“. Ich kann nicht geschichtsphilosophisch-anthropologische Reflexionen über mich selbst oder die Beweggründe meiner Mitstreiter anstellen. Oder anders: Ich kann es nicht, wenn ich den nun einmal gewählten Untersuchungsansatz wähle. Mit derlei Überlegungen würde ich – ganz der Kritik Bernard Williams entsprechend – „für die Anprangerung der Historik der Historik“ bedürfen. Es geht mir aber gerade nicht darum, aufzuzeigen, dass sich ein spezieller Erzähler geirrt hat, weil er Dinge gefärbt beschreibt. Ich kann auf dieser Ebene nur beschreiben, dass er seinem selbst gestellten Anspruch nicht gerecht wird. Ich kann nicht erklären, warum er diesen Anspruch trotz offensichtlicher Unmöglichkeit nach wie vor hat.
Die Konsequenz des Ganzen? Was bleibt noch?
Es bleibt, sich mit anderen Komplexphänomenen zu befassen – wen interessiert schon die Wahrheit. Anzuerkennen, dass es, so die elementare Frage nach richtig und falsch gestellt wird, keine Antwort geben kann. Dinge wollen gewusst werden, weil sie gewusst werden wollen. Es interessiert, weil es interessiert. Es ist Wissenschaft, weil es Wissenschaft ist. Es ist richtig, weil es richtig ist. Oder sein will, das zu entscheiden sei meinen Zuhörern selbst überlassen.
mops-block
Julia Küppers III
- Details