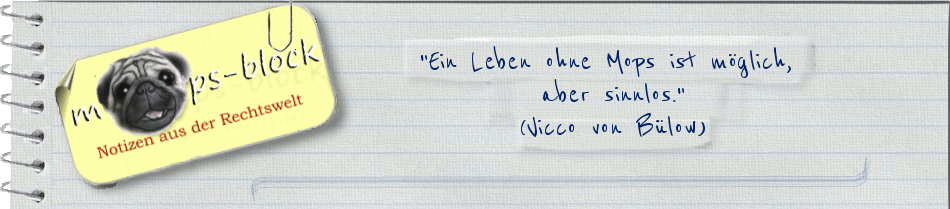Rekonvaleszenz ist ein mühsames Geschäft. Der Körperbetrieb frisst den größten Teil des Tages. Gehen, Laufen, Marschieren, allerlei mehr oder minder lächerliche Übungen zur Wiedergewinnung früher nachlässig, fast schon bewusstlos geübter Beweglichkeit, Haltung, Kraft. Wer ständig auf den Körper achten, ihm zuhören, ihn füttern, loben oder tadeln muss, der braucht, absorbiert vom Fleischlichen und ohne Chance auf schöpferische Frische, Zerstreuung.
Dafür gibt es reichlich Angebote. Fernsehen in erster Linie. Man liegt oder sitzt vor dem Apparat und sieht Ungeahntes, Unglaubliches, niemals Vorgestelltes. Programme, die selbst der hechelndste Kulturkritiker nicht wahrnehmen würde, so tief unter seiner kritischen Würde flimmern sie daher. Bilder, die man weder sehen möchte, noch ansehen sollte. Der schwärzeste Teil der Menschheit grinst und blökt den an, der bislang Tagesschau und Sonnabend-Krimi schon für eine Zumutung hielt. Das ist nicht uninteressant, teilweise sogar aufregend, wird aber schnell langweilig und ist der Rekonvaleszenz nicht förderlich.
Also: Hören statt Sehen. Wer nach dem Motto von Wilhelm Busch gelebt hat, „Musik wird störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch verbunden“, der wird im Zustand schwächlicher Demotivation nicht zum andächtigen Konzerthörer. Bleibt das krude Hoppla-Hop, der süffige Schlager – All You Need is Love, Love – der zwar Erinnerungen weckt, aber die sind 45 Jahre alt, und es ist ziemlich unklar, ob sie ermutigend sind. Außerdem kann ein Gesundender selbst den Beatles nicht länger als eine Stunde zuhören.
Natürlich hat der Deutschlandfunk (von anderen Sendern wird man kränker) noch Vieles zu bieten: Nachrichten, Presseschau, Literatur, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft etc., aber alles ist kurz, knapp und anspruchsvoll, wenn man von Wetter, Autostau, Sport und Börse (4 überflüssige Kapitel in einem großen Konzept) absieht, d.h. setzt einen gesunden und wachen Verstand voraus, ohne ihn fundieren zu können.
Bleibt immer noch die Hörbuch-Lösung. Der unübertreffliche und daher auch nicht übertroffene Gerd Westphal wurde freilich mit seinen Klassikern von mir schon mehrfach abgehört und die Aufbauwilligen wollten mir etwas Neues bieten. Ich erhalte die „Liebesblödigkeit“ von Wilhelm Genazino. Der pingelige und detailskurrile Mannheimer ist mir wohlvertraut. Ich lese ihn gern. Die Unfähigkeit des Protagonisten und Apokalyptikers sich zwischen den Vorzügen der einen Dame und den alsbald wieder in den Vordergrund tretenden Vorzügen der anderen zu entscheiden, hat mir vor einigen Jahren eingeleuchtet und mich amüsiert. Jetzt schlafe ich ein. Immer wieder. Von Ermunterung keine Spur. Der reisende Apokalyptiker mit den läppischen Texten und ausgeleierten Seminaren deprimiert mich. Vielleicht liegt es an der Lesung. Der Autor hat seinen Text selbst gelesen. Er liest nicht gut. Irgendwie unbeteiligt, als wäre er seines Textes überdrüssig. Die Stimme des Apokalyptikers habe ich anders im Ohr. Ich könnte ihn besser vorlesen – glaube ich. Gerd Westphal erst recht. Aber der ist tot. Und Genazino ist nicht Fontane.
Sehen, Hören, Lesen. Quartum non datur. Aber Lesen ist anstrengend. Soll ich tatsächlich, wie es das kühle Kalkül nahelegt, mit der sicheren Aussicht auf mehrere ruhige Wochen, endlich wenigstens einige jener Texte zur Hand nehmen, welche ich schon immer ... und auf jeden Fall, irgendwann ... bei nächster Gelegenheit zu studieren gedachte? Den bewundernswerten Kommentar zu Wittgensteins „Philosophische Untersuchungen? Die letzten 300 Seiten von Musils „Mann ohne Eigenschaften“? Aristoteles‘ „Rhetorik“ nicht nur in Auszügen, sondern wirklich ganz? Goethes Gespräche mit Eckermann – ein hübsches backsteindickes Taschenbuch aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts? Der Vorsatz war gegeben. Es ist dabei geblieben. Der Zufall hat sich mühelos durchgesetzt. Genauer: 2 Zufälle. 2 Bücher in 6 Wochen!! Ein echtes Rekonvaleszenten-Ergebnis.
Das erste wurde mir geschenkt. Von Kurt Graulich. Kurt Graulich schenkt, was mich betrifft, pädagogisch. Wenn er meint, es würde mir gut tun, könne mir nützen, würde mich fördern. Besonders dann, wenn ich einen Titel erwähnt habe mit dem Bemerken, dieses Produkt würde ich keinesfalls lesen wollen, finde ich es wenige Tage später in meiner Post. Er setzt arglistig auf den Zwang, den Freundschaftsgaben unweigerlich mit sich führen. Irgendwann muss man dazu Stellung nehmen. Ich habe von dieser List oft profitiert – z.B. bei der Zwangslektüre der „Wohlgesinnten“ von Jonathan Littell (Myops 7, 2009, 71-76) – und meine Vorurteile entsprechend korrigiert. Meines Wissens bin ich nur in einem einzigen Fall absolut standhaft geblieben: bei den „Erinnerungen 1982 – 1990“ von Helmut Kohl, wo ich mich dann doch lieber auf meine Erinnerungen verlasse als auf die Gespinste meines dicken Landsmannes.
Jetzt schickte er mir Ferdinand von Schirach, „Der Fall Collini“ (Piper, 6. Auflage 2012) obwohl er Grund zu der Vermutung hatte (er kennt mich schließlich), daß ich das Urteil von Derleder (Myops 13, 2011, 44-49), schon wegen meiner Freude an Derleder, billigen würde, Derleder, der meinte, jeder Reflektierende müsse „eigentlich in Scham darüber geraten, daß er diesem Autor bei der Lektüre verfallen ist“.
Das zweite Buch wurde mir ebenfalls geschenkt. Aber nicht von Kurt Graulich, sondern von seinem Verfasser, dem hochgeschätzten Justizbeobachter und Journalisten Rolf Lamprecht, „Ich gehe bis nach Karlsruhe. Eine Geschichte des Bundesverfassungsgerichts“(DVA 2011).
Entsprechend meiner gedämpften Auffassungskraft las ich zuerst den Krimi. Ich verfiel ihm nicht. Er ist gut konstruiert. Ein Mord an einem alten unauffälligen Mann, der sich freilich als angesehener, allseits geschätzter Bürger und reicher Unternehmer entpuppt. Der Täter überlässt sich selbst der Polizei, schweigt, und will sich sichtlich nicht verteidigen. Ein junger Anwalt wird zum Pflichtverteidiger bestellt und nimmt sich dieses, seines ersten Falles mit Feuereifer an. Der Eifer erlahmt auch nicht, als er feststellt, daß der Ermordete sein großväterlicher Freund gewesen ist. Auch die Enkelin des Toten, einst keusche Jugendfreundin des Pflichtbewussten, jetzt umstandslos ein bißchen mehr (im Stehen, am Fenster) kann ihn nicht von seiner Verteidigung abbringen. Und schon gar nicht kann ihn der alte, erfahrene und große (Prof. Dr.!) Anwalt einschüchtern, der die Nebenklage vertritt. Der Täter, Fabrizio Collini und Italiener, schweigt – überhaupt und im Besonderen über sein Motiv.
Der Prozess beginnt. Der Leser ist tatsächlich gespannt, wie der Held der Kolportage jetzt agieren wird. Irgendeine Idee muß her, soll sich auf den folgenden 100 Seiten noch etwas ereignen. Ist der Leser Jurist und kennt Berlin ein wenig, so darf er sich bis dahin durch den lakonischen Ton und die flache, schnörkellose Diktion des Autors gut unterhalten fühlen. Allenfalls wird er sich ein wenig langweilen, denn die volkspädagogischen Ausführungen über die Arbeit des Ermittlungsrichters, die ätzenden Umstände einer Obduktion, die detailgetreue Schilderung der Verhältnisse im Strafgericht Moabit – von der Geschäftsstelle bis zum Sitzungssaal – und viel anderes Advokatenjuristisches werden ihm kaum einen neuen Blick bescheren. Aber der Laie vom Lande darf sich bestens unterrichtet fühlen.
Die Idee kommt dem Verteidiger spät und, nicht sonderlich einleuchtend, erst beim Betrachten einer Fotografie der Tatwaffe – einer Walther P 38, der Standard-Dienstpistole der Deutschen Wehrmacht. Als er daraufhin nach Ludwigsburg zur anschaulich beschriebenen Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Kriegsverbrechen fährt, wird auch dem Leser klar, worauf die Geschichte hinausläuft: auf die seit dem Auschwitzprozess immer wieder erzählte (siehe Costa-Gavras: Music Box!) und sicher hundertfach wahre Mär vom gütigen und geliebten Großvater, in dem ein SS-Schlächter verborgen ruht.
Und so kommt es denn auch. Wobei dem Autor ein nicht unplausibler Einbau unserer durch und durch missglückten „Aufarbeitung“ in seinen Text gelingt – einschließlich des berüchtigten schon vor mehr als einem Jahrzehnt von Hubert Rottleuthner präzise aufgedeckten Verjährungsskandals (Hat Dreher gedreht? Rechtshistorisches Journal 20, 2001, 665-679), den der dubiose Ministerialdirigent Dr. Eduard Dreher (einige Gutmütige glauben immer noch: unabsichtlich) herbeigeführt hat. Wobei es durchaus angebracht gewesen wäre, wenn von Schirach seinen anhangweisen Dank auch auf den schön rapportierten Text von Rottleuthner ausgedehnt hätte.
Nachdem der Gastarbeiter F.Collini auf solche Weise als Rächer seiner Familie zwar nicht entschuldigt, aber verständlich gemacht wurde, hat der Autor seine Geschichte an eine Stelle geführt, an der „im wirklichen Leben“ ein äußerst delikates und schwieriges Urteil zu fällen gewesen wäre. Sich hier etwas auszudenken, wäre für den insgesamt klischeelastigen und von poetischer Phantasie nicht betroffenen Text eine hübsche Pointe geworden. Aber das lag dem Autor sichtlich nicht, weshalb er den Collini mit der klassischen Lösung jeder Aporie durch Selbstjustiz entschwinden lässt.
Der Junganwalt steht betrübt, aber siegreich im Gerichtssaal, der Prof. Dr. Anwalt möchte ihn als Sozius und fährt in die Ferien, die geliebte Enkelin zittert ein wenig und ist was sie ist.
Für einen Rekonvaleszenten gerade recht. Die Welt des Rolf Lamprecht ist weniger schlicht (siehe Rekonvaleszenz II)
mops-block
Rekonvaleszenz I
- Details