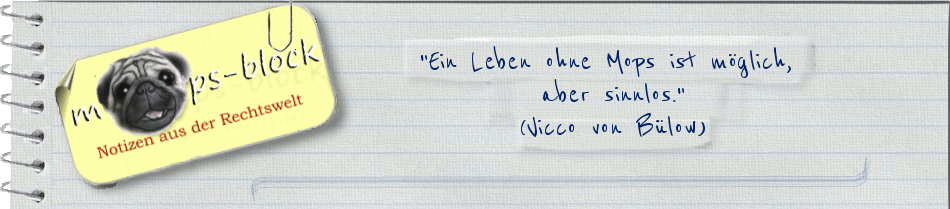In deutschen Krankenhäusern geht es schrecklich zu. Hat man immer schon einmal gehört. Von vergessenen Messern im Bauch des Patienten, von der Operation am Blinddarm statt, wie vorgesehen, am Knie, war immer schon einmal die Rede. Aber in letzter Zeit häufen sich die Berichte. Ärzte brechen ihre Schweigepflicht titelte Die ZEIT und publizierte in ihrem Magazin vom 10. Mai 2012 eine ganze Serie haarsträubender Aussagen. Und knapp 14 Tage später hat S. Seymour Mikich unter dem Titel „Enteignet“ in der FAZ ihre Höllenfahrt durch eine deutsche Klinik und ihre Insassen geschildert.
Normalerweise liest man solche Berichte mit einer Mischung aus Angst („hoffentlich bleibe ich von derlei verschont!“) und wohligem Grausen („mir fehlt, dem Himmel sei Dank, nichts dergleichen“). Irgendwie vermag man diese Nachrichten vom Fremderlebten auch nicht völlig zu glauben. Es fehlt, wie bei Berichten über Attentate und Katastrophen am Ende die Anschauung. „Eine gigantische Welle“, „die ungeheure Explosion“ – wem nichts Ähnliches zugestoßen ist, versucht vergeblich, in den Worten die Zerstörung zu erleben.
Mir geht es nicht so. Ich lese diese und viele andere Texte ähnlicher Art mit dem Sachverstand des Experten. Denn ich HABE Erfahrung. Am 30. April 2012 wurde ich operiert. Wenige Tage zuvor hatte man – eher zufällig – ein Speiseröhrenkarzinom entdeckt. Sehr klein, aber sehr gefährlich. Sofortige Operation unabdingbar. Der Operateur – ein bedeutender Arzt und ein Mann, dem ich seit Jahren blindlings vertraue, tat sich schwer mit seiner Beratung. Einerseits wollte er mich gern operieren, weil er mir das Beste angedeihen lassen wollte, das er kannte – und das war er selbst – andererseits war klar, daß Art und Umfang seiner Belastung nicht zuließen, daß er, wie er sagte „rund um die Uhr“ an meinem Bett sitzen könne. Er legte mir nahe, zu Kollegen in Köln oder Zürich zu gehen, weil der „Pflegestandard in der Hauptstadt ...“ Er schüttelte traurig den Kopf. Wir redeten eine gute Stunde. Dann entschied ich mich für den Meister und wurde operiert. Die Operation glückte. Natürlich. Mein Hausarzt geriet in Verzückung als er die Schnitte und Nähte des Zwei-Höhleneingriffs besichtigen konnte. „Großartige Arbeit“.
Als ich aus der Versenkung der Intensivstation auftauchte und „auf Station“ verlegt wurde, in ein mir „zugebilligtes“ Einbettzimmer – wie eine Krankenschwester mit offenbar noch aus vergangenen Zeiten bewahrtem Zungenschlag formulierte – ging es mir zunächst viel besser als heute.
Pneumonie und Lungenembolie hätten sich „eingestellt“, meinte 3 Tage später der zuständige Stationsarzt. Warum und wie sie sich „eingestellt“ hatten, könnte ich heute mühelos und auf die Minute genau rekonstruieren. Aber ich will das Tagebuch nicht mit einem nutz- und damit sinnlosen Lamento verunzieren.
Nur soviel: Wenn ein Frischoperierter 18 Stunden ohne zureichende Schmerzversorgung (die Peridualanästhesie-Pumpe ist offenbar etwas, wofür man ausgebildet sein muß – es waren aber nur Azubis vorhanden) gelassen wird, er sich vor Schmerzen windet, auf das Bemerkenswerteste, nämlich brüllend hustet und rasselnd röchelt und auf sein wütendes Klingeln von der Stationsschwester mürrisch gefragt wird, was „denn jetzt schon wieder“ sei, wenn die diensthabende Ärztin, für die Schmerzen „die bekannt schlechten Betten“ verantwortlich macht und 1 Voltaren anbietet, wenn der Pfleger am Handy lautstark seine familiären Querelen beilegt, während er mit der freien Hand zerstreut in den Flaschen und Fläschchen auf seinem Wagen wühlt, um schließlich doch noch etwas aufzuhängen, „was jetzt dran sein müsste“ - dann, ja dann wird sich niemand wundern, wenn sich etwas „einstellt“.
Die Ursachen sind klar: der menschliche Faktor. Den könnte man beseitigen durch drastische Vermehrung des Personals, durch eine der sehr schweren Arbeit angepasste, weit überdurchschnittliche Bezahlung, und eine – bei solchen Vorgaben leicht realisierbare – strikte Selektion der Beschäftigten. Aber dann müssten die Kliniken auf Gesundung und nicht auf Gewinn programmiert werden.
So kam es, daß ich 8 Tage länger im Krankenhaus bleiben musste als der Meister vorgesehen hatte und dort vermutlich auch endgültig geblieben wäre, hätte Regina Ogorek nicht scharf und ohne sich und andere zu schonen gewacht und aufgepasst und mich endlich aus der „Klinikmaschine“ (Seymour Mikich) herausgezogen, von deren Verwüstungen ich mich nur langsam erhole.
Immerhin habe ich nach 10 Wochen den Mops-Block heute wieder aufgemacht, gesehen, daß Regina nichts geschrieben hat (wann hätte sie gesollt?), gelesen, was Rainer über die Vorhäute verlauten ließ (das Sanctum praeputium, von dem auch ein paar Pfund in der Welt existieren, hat er vergessen), und studiert, was der dritte Praepudiatus im Bunde von den Rostocker Verwaltungsidioten zu berichten weiß.
Die Welt, aus der ich fast 10 Wochen ausgetreten war, hat sich nicht verändert: Spanien ist immer noch Europameister, Griechenland zahlt seine Schulden genau so wenig wie zuvor, die Amerikaner drohen dem Irak und umgekehrt, die Börsen gehen rauf und runter, der Euro soll gerettet werden, aber die Umwelt nicht. Man muss sich wirklich fragen, ob man wieder eintreten soll. Aber angesichts der ganz und gar unbekannten, völlig unverstellten und eigentlich auch unbegreiflichen Äußerungen von Zuneigung und Liebe (!) bleibt nichts übrig als sich wieder einfädeln zu lassen.
mops-block
Im Krankenhaus
- Details