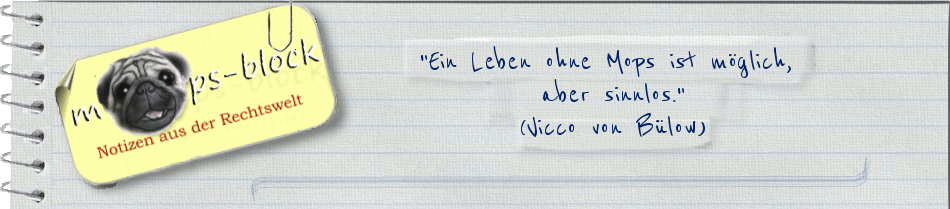Eingeladen in den Lions Club Berlin. Er hat einen weiblichen Zweig mit einer Freundin als Vorsitzender, die mir den Auftrag erteilt, an Wissenschaft interessierten Damen, die aber keine Wissenschaftlerinnen sind, etwas über Wissenschaft zu erzählen, was jeder versteht und das doch nicht langweilig ist. Ich habe mich angestrengt. Das Ergebnis ist hier zu besichtigen
Baronessen und Barone
Eingeladen, etwas nicht allzu Fachspezifisches, aber dennoch Wissenschaftliches und hinlänglich Interessantes vorzutragen, irre ich in meiner Wohnung umher. Mein Blick fällt auf einen knapp 10 Jahre alten Katalog, den die Museumsstiftung Post und Telekommunikation publiziert hat, damit er eine von ihr auf den Weg gebrachte, große Wanderausstellung begleite. Der Titel dieser ungewöhnlich aufwendigen Präsentation lautet: „Das Netz. Sinn und Sinnlichkeit vernetzter Systeme“. In Wort, Bild und Schrift werden alle Netzwerke präsentiert, mit denen wir uns mehr oder weniger intensiv beschäftigen – beginnend mit der neuronalen Informationsverarbeitung, die als „Netzwerk des Lebens“ vorgestellt wird, über die sozialen Netzwerke von Verkehr und staatlicher Versorgung bis hin zu den telekommunikativen Netzen, in denen wir inzwischen schon alle hängen. Damit habe ich mein Thema für heute: „NETZWERKE“ oder, um der Sache auch noch einen geheimnisvollen Akzent aufzusetzen, „Baronessen und Barone“.
I.
Ich beginne etymologisch. Obwohl die Sache relativ jung zu sein scheint ist das Wort Netzwerk keineswegs eine neue Schöpfung. Es ist sogar viel älter als das heute dominierende Wort „network“, das der moderne Deutsche gern benutzt, um unauffällig sowohl seine transatlantische Gewitztheit als auch seine Vertrautheit mit dem Computerzeitalter unter Beweis zu stellen.
„Netzwerk: etwas Netzartiges“, erklärt uns das ehrwürdige, immer noch in Bearbeitung befindliche Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm und beruft sich dafür auf ein inzwischen mehr als 200 Jahre altes Zitat aus Wieland: „die Kinder zupften an den Troddeln und dem Netzwerk seiner Jagdtasche“. Aber auch weniger sinnliche Verwendungen sind bereits belegt: „Daß man mich nicht etwa in ein dialektisches Netzwerk zu verwickeln meine“ bemerkt abwehrend ein philosophisch ambitionierter Zeitgenosse von Wieland.
Heute wird „Netzwerk“ vorwiegend verwendet, um politische, geschäftliche oder persönliche Verbindungen und Beziehungen zwischen Menschen oder Institutionen zu bezeichnen. Früher wäre niemand auf den Gedanken gekommen, das kunstvolle Bündnissystem des Bismarckreiches ein Netzwerk zu nennen oder davon zu sprechen, daß Jesus mit seinen Jüngern gut vernetzt gewesen sei.
Inzwischen können auch unpersönliche, rein technische Verhältnisse, wie Verkehrsverbindungen zu Wasser und zu Lande, Systeme der Sozialversicherung, Einkaufsnetze, Informationsstrukturen und Archivkomplexe als Netzwerke bezeichnet werden.
Bei einem solchen Übermaß an Anwendungen ist das Auftreten von makro- und mikrosoziologischen Exzessen nicht verwunderlich.
So kann man da und dort lesen, daß die gesamte menschliche Gesellschaft, wenn man sie nur als globalisierten und digitalisierten Kapitalismus zu bewerten bereit ist, als „Netzwerkgesellschaft“ anzusprechen sei. Andererseits kann aber auch von einem einzelnen Menschen gesagt werden, er sei so vernetzt gewesen, „daß er den richtigen Weg nicht mehr sehen konnte“. Ein köstlicher Satz: Das Vernetzungslabyrinth als die Ursache von Verirrung und Sprachlosigkeit.
Sieht man von dem modischen Habitus, sich mit verbalem Zierat verschiedenster Provenienz auszustaffieren ab, dann ist der Grund für den ausufernden Gebrauch des Terminus „Netzwerk“ sicher im faktischen Zusammenrücken unserer Welt, aber auch in der sowohl politisch als auch organisatorisch begründeten Anfeindung und Zurückdrängung aller Arten von Hierarchien zu finden. Also „Netzwerk“ als demokratisches Postulat.
II.
Im wissenschaftlichen Raum, in welchem sich Hierarchien bekanntlich besonders zäh halten, sind Begriff und Modell „Netzwerk“ dementsprechend relativ spät aufgetreten. Noch heute begegnet uns dort die Vorstellung von der möglichen Existenz von Netzwerken weniger als Beschreibung denn als Forderung.
Sind es Wissenschaftspolitiker, die sich Netzwerke wünschen, dann denken sie vorwiegend an finanzielle Einsparungen. Sie reden dann meistens von Synergie und meinen damit, daß die Zusammenfassung, die gemeinsame Leitung und Leistung von zwei, drei oder vier wissenschaftlichen Instituten bedeutsamer und fruchtbarer sein werde, als es die Addition der Einzelleistungen von zwei, drei oder vier Instituten jemals sein könne.
Was natürlich ein Irrtum ist, den man bei ökonomisch quantitativen Spekulationen nicht selten erlebt. Weder bringt das Zusammenschütten von Zucker und Salz eine neuartige und gesteigerte Würze zustande, noch hat die Hinzufügung von, sagen wir: drei, Nullen zu einer Eins automatisch die Entstehung eines Tausenders zur Folge. Aber solche Erfahrungen werden sich selbstverständlich gegen ein so begehrenswertes und verheißungsvolles Fremdwort wie Synergie niemals durchsetzen können.
Wissenschaftler fordern Netzwerke unter anderem dann, wenn sie die Absicht haben, zu verhindern, daß pro Institut einmal jährlich das Rad neu erfunden wird. Oder wenn sie sich mit ihren in- und ausländischen Kollegen austauschen und etwas aufschnappen möchten, was sie noch nicht wissen. Oder auch, weil sie hoffen, Synergie aus höhergestelltem Munde könne bedeuten: „die Verwaltungsarbeit machen ab sofort die anderen“. Weil die anderen aber genau dasselbe denken, und Neid und Konkurrenzphantasien nicht bloß in der bösen Wirtschaft, sondern auch in der guten Wissenschaft zuhause sind, wird aus den von den Wissenschaftsorganisationen favorisierten Vernetzungsprojekten in der Regel nicht viel.
Schließlich ist die Forderung nach Netzwerkbildung überall dort modern, wo Wissenschaftler unter der beispiellosen Fragmentierung und Zersplitterung ihres Arbeitsfeldes leiden, aber dennoch den Traum von der Einheitswissenschaft noch nicht aufgegeben haben. Was über Jahrzehnte unter den Stichworten „Interdisziplinarität“, „Multidisziplinarität“ und „Transdisziplinarität“ bearbeitet wurde, findet sich inzwischen, neu sortiert, unter der Überschrift „Vernetzung“ wieder. Chemie muß sich mit Biologie vernetzen, Physik mit Erkenntnistheorie, Medizin mit Informatik. Auf diese Weise entstehen neue Wissensfelder, neue Problemlösungen, neue Erkenntnisse und neue Disziplinen. Die Überspezialisierung und Zersplitterung der Wissenschaften wurde durch diesen Vorgang bislang allerdings noch nicht beseitigt.
III.
Wie wir sehen, werden Netzwerke in der Wissenschaft zwar einerseits durchaus positiv bewertet, haben andererseits aber das Stadium eines Projekts überwiegend noch nicht überwunden.
Wer sich mit dieser Feststellung zufrieden gäbe, hätte übersehen, daß es in der Wissenschaft doch einen kleinen Bereich gibt, in dem seit geraumer Zeit gut eingearbeitete und effektiv funktionierende Netz werke existieren, über die wenig Negatives zu berichten ist.
Über sie zu reden lohnt sich um so mehr, als öffentlich nicht häufig von ihnen gesprochen wird. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, daß sie nicht wirklich sichtbar sind, selten gepriesen und vielfach sogar totgeschwiegen werden.
Die respektlosen und mehrheitlich ungebildeten Amerikaner nennen solche Netzwerke, gelegentlich old boys network, was ich aber, als humanistisch gebildeter, alteuropäisch denkender und, wie es sich heute gehört, gemäßigt antiamerikanisch fühlender Wissenschaftler, der nach wie vor darauf besteht von „Elfmetern“ und nicht von „penalty-Schießen“ zu reden, entschieden ablehne.
Allerdings ist es nicht leicht eine ebenso treffende und makellose Bezeichnung für das Phänomen, um das es hier geht, zu finden.
So ist uns zwar, auch aus der Wissenschaft, der Ausdruck „Seilschaft“ wohlbekannt. Es handelt sich jedoch um einen kritischen Begriff, der zur Kennzeichnung eines Sachverhaltes verwendet wird, dessen Entstehung es möglichst zu verhindern gilt.
So hat der Wissenschaftsrat als er eine Anhörung durchführte, bei der es um die Möglichkeit ging, eine überregionale wissenschaftliche Einrichtung zu gründen, mit der neunten von insgesamt elf Fragen, die er den Vertretern verschiedener Wissenschaftsorganisationen vorlegte, folgendes gefragt: „Welche Regeln der Kooptation müssen vorgesehen werden, um ’Seilschaften’ zu verhindern?“
Die Befragten waren sich allerdings einig, daß das Phänomen zwar hier und da existieren könne, daß es aber in der wissenschaftlichen Szene Deutschlands keine herausragende Rolle spiele.
Nicht wenige derjenigen, die solches beteuerten, waren wenige Jahre zuvor noch ganz anderer Ansicht gewesen. Damals – es war Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts – waren sie damit beschäftigt, das Wissenschaftssystem der untergegangenen DDR zu evaluieren.
Bei der Ermittlung und Prüfung von Institutionen, Projekten und Forschern, die in das gesamtdeutsche Wissenschaftssystem eingepaßt werden sollten, stießen sie immer wieder auf sorgfältig verschwiegene, nur durch Zufall aufzudeckende Beziehungen und Verflechtungen. Zweck und Funktion dieser, keineswegs nur auf intime Freundschaft gegründeten, Verbindungen war offenbar die wechselseitige Beratung der Beteiligten, die Förderung ökonomischer Interessen, die Protektion gemeinsamer Schüler, die diskrete Beschaffung von Bescheinigungen und die unauffällige Erledigung all jener kollektiven Anliegen, die einer verschwiegenen Regulierung bedürftig und zugänglich sind.
Die Bezeichnung „Seilschaft“ für diese Verbindungen wurde rasch zum Gemeinplatz und schließlich zum Pfuiruf, der die ursprünglich positive Konnotation des Begriffs verdrängte, nämlich das existentielle aufeinander Verwiesensein der am gemeinschaftlichen Seil Hängenden, die auf Gedeih und Verderb durchzuhaltende Verbundenheit der zu solidarischer Erkundung Aufgebrochenen.
Deswegen wäre es nicht glücklich, wenn wir uns durch die – rein und lediglich – strukturelle Ähnlichkeit des old boys network mit Seilschaften zu einer Bezeichnung verleiten lassen würden, die unangebracht negative Assoziationen hervorrufen müßte.
Das gleiche gilt für die so genannten „Amigo-Verbindungen“, wie sie erstmals im Jahre 1993 in Bayern aufgetreten sind und seither als ingeniöse sachlich-persönliche Mischung aus Politik und Wirtschaft gelten. Sie haben offensichtlich wenig bis nichts mit Wissenschaft zu tun und sind schon deswegen selbstverständlich den hier erörterten, rein wissenschaftlichen Verbindungen absolut wesensfremd. Der Umstand, daß die Beziehungsgeflechte der old boys im Verborgenen wuchern, sich niemals selbst präsentieren, mühsam ausfindig gemacht werden müssen und bei zufälliger Entdeckung dazu neigen ihre Existenz zu verleugnen, rechtfertigt noch nicht, sie nunmehr als „los amigos“ zu titulieren. Denn auch hier würden sich die erwähnten falschen, nämlich negativen Assoziationen einstellen.
Orientiert man sich auf der Suche nach einem angemessenen, unamerikanischen Ausdruck für die wissenschaftlichen Beziehungsgeflechte an deren praktischer Bedeutung, dann ist jedenfalls klar, daß es sich um ein wirkungsmächtiges Myzel handelt, das nicht dem Vollzug von Forschung, sondern deren Organisation, Kontrolle und Beherrschung zu dienen bestimmt ist.
Das eben ist der Unterschied zu Seilschaften und Amigobeziehungen. Seilschaften arbeiten zusammen und begünstigen sich wechselseitig auf den Ebenen von Macht und Mission. Glaubensgemeinschaften, weltliche und geistliche Orden, Lehrer-Schüler-Verhältnisse, Denkschulen aller Art sind die typischen Nährböden für Seilschaften.
Auch Amigoverhältnisse arbeiten zusammen. Sie wirtschaften nach dem bekannten Prinzip „eine Hand wäscht die andere“ und konzentrieren sich auf die Schnittstelle von politischer und ökonomischer Macht.
Das wissenschaftliche Netzwerk dagegen regiert autonom im Bereich des Reingeistigen.
An dieser Stelle zeigt sich, daß für das old boys network sogar der Ausdruck „Netzwerk“ nur bedingt zutrifft, weil es letztlich kein „Netz“ im Sinne der heutigen Wortverwendung, sondern ein hierarchisches Regiment ist. Ich habe deshalb gelegentlich die Bezeichnung „Kryptonetzwerk“ vorgeschlagen, um einerseits das Verborgene, Kryptische, und andererseits das Unechte dieses „Netzwerkes“ zum Ausdruck zu bringen. Aber mein Vorschlag hat sich nicht durchgesetzt.
Heute scheint mir der aus dem italienischen Wissenschaftler-Slang stammende Name baroni für die Angehörigen eines wissenschaftlichen Beziehungsgeflechts der hier in Rede stehenden Art nahezu unübertrefflich. Der Ausdruck vermeidet nicht nur elegant das plumpe old boys network, sondern bringt auch das Adlige, also das Elitäre, Unauffällige und Bedeutsame plastisch zur Anschauung.
Außerdem müssen wir davon ausgehen, daß die schamlose Zurücksetzung potenter Frauen sogar in der Wissenschaft eines Tages ein Ende finden wird, so daß Frauen nicht nur in Netzwerken auftauchen, sondern auch selbst solche bilden werden. Bevor dann der schreckliche Gedanke auftaucht, man müsse solche Bildungen als old girls network bezeichnen, sollte sich Baronesse als Pendant zu den zu den baroni durchgesetzt haben.
IV.
Im Folgenden werde ich mich mit zwei analytischen Blicken auf das Netz der Barone beschäftigen, Blicke, die Sie als Prophezeiung für das Zukunftsnetz der Baronessen nehmen dürfen, denn bisher hat sich auf keinem Feld gezeigt, daß mächtige Frauen fundamental anders handeln als mächtige Männer – allenfalls, daß sie männlicher als Männer handeln können, darf als erwiesen gelten.
Zunächst kommen einige Aspekte der Tätigkeit und der Organisation der Netze zur Sprache. Anschließend befasse ich mich noch mit den Mitteln zur Aufspürung und Lokalisierung solcher Netze. Denn ihre Wirkung im Unsichtbaren könnte Gut- und Leichtgläubige dazu verführen, sie für Hirngespinste zu halten.
1. Das Netz regiert.
Geheime Regentschaft hat immense Vorteile für die Regierten. Sie wissen von nichts, bleiben unbelastet, weil uninformiert, hätscheln keine enttäuschten Hoffnungen und können in Ruhe alle Vorteile sanfter Führung genießen.
Zum Beispiel wird kein Streit publik, wenn es um die Beratung über potentielle Nachrücker in bestimmte Gremien geht. Anmutig entfaltet sich des homo academicus liebste Tätigkeit: das Parlieren über und das Bewerten von Kollegen. Informationen und Meinungen werden diskret ausgetauscht. Andeutungen summen über den Kaffeetassen, hochgezogene Augenbrauen und bedächtiges Nicken beherrschen freundlich lächelnd die Szene.
2. Das Netz ist überall.
Eine dichte wechselseitige ex-officio-Vertretung produziert den Schein der Allgegenwärtigkeit. Dadurch wird der Eindruck von Allmächtigkeit erweckt, der Vertrauen stiftet für Entscheidungen, die den baroni zugerechnet werden. Tatsächlich sind die baroni nicht überall, aber sie haben überall ihre OHREN. Diese sitzen in den Gremien, stöbern in den Vorzimmern, huschen durch die Empfänge, telefonieren mit Sekretären und Administratoren. Totalitäre Regime leben von ihren Denunzianten. Die baroni beschäftigen ihre OHREN.
3. Das Netz evaluiert.
Evaluationen sind à la mode. Keine Mittelbewilligung ohne Evaluation. Kein Antrag ohne Gutachten. Kein Projekt ohne mehrfache Bewertung. Der Bedarf an Experten steigt täglich. Alle baroni sind oder waren Experten. Aber sie fertigen schon lange keine Expertisen mehr. Sie sagen, wer eine Expertise machen könne, und bestimmen damit, wer eine machen darf. Die baroni bilden das Steuerungskartell der wissenschaftlichen Evaluationen.
4. Das Netz ist fürsorglich.
Fürsorge ist eines der beliebtesten Herrschaftsmittel der Alten über die Jungen. Die baroni sind in der Regel alt, alte Herrscher, Gerontokraten. Sie huldigen dem Gedanken, sie müßten wissen, was für jene gut ist. Manchmal ist das richtig. Meistens nicht. Denn obwohl Gerontokraten vielfach als weise gelten, ist noch immer gewiß, daß auch die größte Weisheit nicht in die Zukunft zu sehen vermag. Weisheit ist ein schlechter Ratgeber, wenn es um die Arbeit am Futur geht. Schließlich ist es nicht die eigene Zukunft, die der Gerontokrat plant. Er hat keine mehr. Er verplant die Zukunft der anderen. „Wir wollen nur Euer Bestes“ riefen die Geronten 1968 den Jungen zu. „Wir geben es Euch nicht“ riefen die zu Recht zurück.
5. Das Netz strebt nach Alleinherrschaft.
Bottom up - Netze werden verhindert. Sie wirken demokratisierend und schwächen nachhaltig die Steuerungspotenz der auf Zentralisierung drängenden Spitzenbarone der Wissenschaftsorganisation.
Top down - Netze werden ebenfalls verhindert. Sie ähneln zu sehr den zahllosen, mit Vorliebe internationalen Verträgen über Zusammenarbeit und Austausch, die - wie früher die periodischen Amnestien - an Festtagen über die verschiedensten Einrichtungen kommen. Nach einigen wechselseitigen Arbeitsbesuchen flaut der Wind ab und eine Kooperations-Fahne mehr hängt schlapp am Mast der Forschungsstätte. Deshalb lieber gleich: was bleibt und entscheidet ist das Netz der baroni.
6. Das Netz lebt aus sich selbst.
Es kooptiert diejenigen, die dazugehören sollen und scheidet jene aus, die sich als ungeeignet erwiesen haben. Eine Wahl findet weder im Öffentlichen noch im Geheimen statt. Die „Zuwahl“ ergibt sich. Baronisieren ist ein alter und vortrefflicher Ausdruck für diese Art von Erhebung in den Stand der „Freiherren“. Auf Selbstähnlichkeit wird dabei nur für den Regelfall Wert gelegt. Einige exzentrische Legitimationsfiguren sind gern gesehen und werden zur Tarnung und als Toleranznachweis gleichfalls baronisiert.
7. Das Netz ist kopflos.
Das Netzwerk hat keine gemeinsame Informationszentrale und kein Sekretariat. Soweit seine Mitglieder nicht durch ihre OHREN gefüttert werden, haben sie viele Kanäle, über die sie alles erfahren. Der traditionelle Kurzspaziergang zu einer Veranstaltung oder zum gemeinsamen Hotel, das gemeinsame Frühstück und der abendliche Champagnerempfang gehören ebenso hierher, wie die vielen medialen Techniken, bei denen das Telefon heute das eher antike, wenngleich noch unverzichtbare Mittel repräsentiert. Jedenfalls: wenn eine für die baroni interessante Figur in einem Vortrag danebengreift oder eine unattraktive öffentliche Erklärung abgibt, weiß es wenige Stunden später das gesamte Netz.
8. Das Netz beschließt nicht.
Obwohl die baroni organisiert sind, treten sie niemals zusammen. Das ist nicht erforderlich, denn das Netzwerk braucht keine gemeinsamen Beschlüsse zu fassen, weil es überhaupt keine Beschlüsse faßt. Seine Angehörigen sind Experten. Als solche wissen sie, wovon sie reden und beziehen aus ihrer Professionalität ihre Kriterien und ihre Maßstäbe. Viele Entscheidungen, vor allem solche der Bewertung von Kollegen, könnten sie treffen, ohne ein Wort zu verlieren.
Bei Frühstückskartellen der Wirtschaft muß immerhin noch der eine oder andere beiläufige Satz gesprochen werden. Etwa: „Wir sehen uns leider gezwungen, demnächst den Preis unserer Ware um 5 Pfennig zu erhöhen“, und schon steigen ohne Absprache auf dem gesamten Markt die Preise um fünf Pfennig.
Die alten Jungs aus der Wissenschaft sehen sich lediglich an, und siehe da: bestanden oder durchgefallen!
V.
Da sich die baroni kaum jemals zu erkennen geben, ist es für die Gewaltunterworfenen eine Überlebensfrage, rechtzeitig zu erkennen, wem sie gegenüberstehen: barone oder professore.
Der zuverlässigste Weg geht über die Identifikation einzelner Akteure, die als Angehörige des Netzes anzusehen sind. Letztlich läuft alles wie bei der Entlarvung einer Bande von Schmugglern oder Terroristen: Hat man erst einmal einen entdeckt, darf man hoffen, nach und nach der ganzen Mannschaft habhaft werden zu können.
Wer dabei erfolgreich sein will, muß sich zunächst eine Reihe einfacher Kriterien und Suchregeln einprägen.
Die erste und Hauptregel lautet, daß es durchweg zwecklos ist, bei der Suche nach Baronen junge Frauen oder junge Männer ins Auge zu fassen. Sie stellen den Netzwerknachwuchs, bleiben aber als Nachwuchs bloße Hoffnungen, auf die nichts gegründet werden kann.
Frauen sind erst in den letzten Jahren und vorerst lediglich in der Politik in Beziehungsgeflechte eingerückt, die man, falls sie sich stabilisieren als Baronessen-Netz wird bezeichnen können.
In der Wissenschaft ist, wie erwähnt, die Geschlechter-Lage nach wie vor noch von mittelalterlicher Gesundheit. Frauen kommen hier überwiegend und immer noch lediglich als sogenannte Begleitung von Netzwerkangehörigen – häufig sogar noch in der Form sogenannter Professorengattinnen – in Betracht und selbst das ist eher selten. Der Grund liegt nicht etwa darin, daß die Barone frauenfeindlich wären oder keine Frauen hätten. Es handelt sich um reine Vorsichtsmaßnahmen. Frauen wissen schon aufgrund ihrer faktischen Nähe zum Baron, aber auch wegen ihrer Beobachtungskompetenz nahezu alles und reagieren gern gefühlsbestimmt.
Erfahrene Spurenleser erkennen daher schon an der Art wie eine Ehefrau lächelt, welchen Rang ihr Mann dem Angelächelten zubilligt
Die typischen Akteure sind also ältere bis alte Männer (der Komparativ ist hier wie in anderen Fällen keine Steigerung sondern eine Abschwächung!) oder besser: alte Herren, die zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens mit gutem Recht als bedeutende Wissenschaftler bezeichnet worden wären. Bedeutende Barone entwickeln sich in der Regel aus exzellenten Wissenschaftlern.
Die in Betracht zu ziehenden Exemplare sind in der Regel solide, aber unauffällig gekleidet; extravagantes Benehmen oder ausgefallene Starallüren sind ihnen fremd. Bei öffentlichen Veranstaltungen (auch solchen nichtwissenschaftlicher Art) sitzen sie meistens in der ersten Reihe.
Das ist allerdings kein sehr zuverlässiges Kriterium, da dort häufig auch die Angehörigen nichtwissenschaftlicher Netzwerke sitzen.
Ähnlich unsicher wäre auch ein Schluß aus dem „Umstand“, wie man, nach altgermanischem Vorbild, die einen Prominenten umstehenden Figuren nennen könnte. Häufig sind es gerade Amigos und führende Seilschafter, die auf Stehempfängen und Partys aller Art von einer dichten Klientel umdrängt werden, während der wissenschaftliche Baron entweder unauffällig beiseite steht oder sich sogar klüglich in den „Umstand“ eingereiht hat.
Für die weitere Ermittlungsarbeit ist man deshalb auf die Beobachtung der Seins- und Verhaltensweisen der Betroffenen angewiesen.
VI.
Ein erster, nicht mehr ganz unbegründeter Verdacht ist gerechtfertigt, wenn man desselben Individuums bei vielen geographisch und sachlich weit auseinander liegenden Gelegenheiten ansichtig wird.
Morgens spaziert es durch die Universität, um die Mittagszeit erblickt man es bei einem Snack mit bekannten Journalisten, Nachmittags steht es bei einem Empfang in einer Botschaft, am frühen Abend partizipiert es an einer Vernissage, Abends sitzt es in einem Vortrag in der Akademie, den es aber in gebückter Haltung und mit gequältem Entschuldigungslächeln vorzeitig verläßt, um nicht allzu spät auf einer Soiree zu erscheinen, zu der ein homo œconomicus eingeladen hat.
Wenn solche Abwechslung sich dann an verschiedenen Orten der Welt ereignet, so daß man sich als Beobachter verwirrt fragt: „Ist das der schon wieder?“ „Oder sieht er ihm nur ähnlich?“ „Habe ich den nicht vorgestern in einem Park in Tokio gesehen und sitzt er jetzt wirklich in diesem Hörsaal in Hamburg?“ (in der ersten Reihe natürlich) – wenn sich die Dinge also so fügen, ist man auf einer vielversprechenden Spur. Die gilt es jetzt durch Detailstudien zu festigen.
Da sich intime Recherchen nicht ohne fremde Hilfe bewerkstelligen lassen, kommt für den Amateur nur der öffentliche Auftritt des potentiellen Netzwerkangehörigen in Betracht, vorwiegend bei Gelegenheit großer Empfänge, wie sie heute im Anschluß an nahezu jedes zitierfähige event stattfinden.
Drei Einzelheiten sind ins Auge zu fassen: Die herzliche anonyme Begrüßung, der ungewiß schweifende Blick und der Umgang mit dem Terminkalender.
Zunächst die Begrüßung: Der Baron hat als großer Funktionär Hunderte von Leuten kennengelernt. Da er alt und viel herumgekommen ist, ist dies nicht weiter verwunderlich. Als er jung war, kannte er fast alle, jedenfalls aber die meisten, mit Namen. Aber jetzt ist er alt und sein Gedächtnis läßt nach. Außerdem waren es früher nicht so entsetzlich viele wie heute. Er hat noch immer wenig Schwierigkeiten mit den Gesichtern, aber der Namen ist er sich nicht mehr sicher. Er weiß, daß er die Leute, die auf dem Empfang vor ihm stehen, kennt beziehungsweise kennen müßte. Er sieht es den Händen an, die sich ihm entgegenstrecken und er entnimmt es den Augen, die ihn erwartungsvoll ansehen.
Da die Nomenklatoren, die im alten Rom den Kaisern die Namen der Eintretenden zuflüsterten, bis heute immer noch und ausschließlich den Kaisern zur Verfügung stehen, wäre der bedeutende Funktionär in einer verzweifelten Lage, hätte er sich nicht längst eine wirkungsvolle Kompensation ausgedacht. Sie besteht in der überschäumenden, herzlichen Begrüßung der Herantretenden, die diese freudestrahlend vergessen läßt, daß sie vergessen sind.
Ein Beispiel: „Sie hier? Welch angenehme, welch entzückende Überraschung. Lange haben wir uns nicht gesehen, obwohl ich schon des öfteren gern ein paar Worte mit Ihnen gewechselt hätte. Und nach unserem flüchtigen Zusammentreffen zuletzt in Zürich – oder war es Rom? – sind wir leider nicht mehr zusammengekommen“.
In der Regel zieht der also Begrüßte beglückt von dannen, wohlig eingehüllt in den charmanten Schaum, den der Bedeutende versprüht hat, und allenfalls leicht irritiert, weil er sich der zitierten Zusammentreffen so gar nicht mehr recht erinnern kann. Nur völlig abgebrühte Teilnehmer durchschauen das Spektakel, aber noch niemals hat sich einer getraut, mit tückischem Grinsen zu fragen: „Und, was meinen Sie eigentlich, wie ich heiße?“
Zweitens: Der ungewiß schweifende Blick.
In engem Zusammenhang mit der namenlosen Begrüßung ist auch der ungewiß schweifende Blick zu beobachten. Der Baron ist ja ein bekannter Mann, den viele begrüßen wollen, der aber seinerseits auch viele begrüßen muß. Dazu gehören zunächst die weiteren Teilnehmer am wissenschaftlichen Netzwerk, seine Logenbrüder gewissermaßen, ferner die Mitglieder prominenter anderer, z.B. politischer oder ökonomischer Verbindungen, schließlich die große Zahl faktisch dienender und potentieller Klienten, die unter Umständen wochenlang auf diesen Augenblick gewartet haben.
Als Folge dieses Begrüßungszwanges schüttelt der wichtige Mann eine immense, fast nicht zu bewältigende Anzahl von Händen, und wird gleichwohl ständig von der Furcht gepeinigt, in diesem Augenblick des Schüttelns vielleicht eine belanglose, nämlich eine bloß freundliche, vielleicht auch freundschaftliche oder sogar verehrende, aber jedenfalls keineswegs wichtige Hand zu bewegen, während eine vordringliche, sachlich bedeutsame, später vielleicht sogar entscheidungsrelevante Hand soeben unbeachtet an ihm vorbeigetragen würde.
Dieser bedrückende Gedanke lenkt seine Blicke schon beim ersten Kontakt mit einem zu begrüßenden Individuum zwangsläufig an diesem vorbei, sie schweifen in Erwartung und auf der Suche nach der wichtigeren Hand über die linke oder rechte Schulter der vor ihm stehenden Person, tasten unbestimmt in die Ferne, gleiten über die Gesichter der zahllosen Handträger im Raum und kehren erst dann flüchtig und zugleich verabschiedend zu der begrüßten Person zurück, wenn die nächste zu ergreifende Hand ermittelt wurde und in Griffnähe gekommen ist.
Obwohl der dergestalt Begrüßte letztlich also überhaupt nicht begrüßt wurde, sind die Wichtigen, da in vergleichbarer Lage, durchaus bereit, sich ohne zu maulen auf dieses Verfahren einzustellen, während die Unwichtigen, auf die es aber nicht ankommt, sich mit dem Gedanken trösten, daß auch ein ganz kleiner Finger noch ein bißchen Hand ist. Diesem Sachverhalt ist es zu verdanken, daß es Empfänge gibt, bei denen absolut niemand mehr irgend jemanden tatsächlich sieht.
Da allerdings auch präsumtive Aufsteiger, Schnorrer und Ehrgeizlinge verschiedenster Couleur den über die Schulter des Gegenüber schweifenden Blick in der Absicht kultivieren, kein bedeutendes Hinterteil, dem zuzuwenden sich lohnen könnte, zu übersehen, darf dieses Kriterium nur im Zusammenhang mit den anderen in Anschlag gebracht werden.
Braucht man also noch weitere Beweise, ist es empfehlenswert einen abschließenden Test im Hinblick auf den Umgang des Verdächtigen mit seinem Terminkalender zu machen.
Normale Menschen werden bei der Frage, ob sie im nächsten Monat an einem beliebigen Tag ein oder zwei Stunden für eine Befragung, eine Beratung, eine Tasse Kaffee etc. erübrigen könnten – abgesehen von dem Fall, daß sie dem Frager auf jeden Fall aus dem Wege gehen möchten – mit freundlicher Bereitwilligkeit reagieren.
Anders ein Mitglied des wissenschaftlichen Netzwerkes. Schon bei dem Wort „Termin“ wird es erschreckt zusammenzucken. Eine gewisse Heiterkeit über die vorliegende Ahnungslosigkeit läßt der Baron durchblicken, wenn die Anfrage sich auf die unmittelbar folgenden 8 – 12 Wochen richtet, eine Heiterkeit, die ihn zu neckischem Abwinken gegenüber seinem eigentlich automatischen Griff nach dem Kalender animiert. Es ist schließlich absolut unnötig, sich die hinlänglich bekannte Zwecklosigkeit einer Suche durch angestrengtes Stieren in das viel genutzte Büchlein zu bestätigen.
Erst wenn sechs oder mehr Monate bis zu einem potentiellen Termin verfließen dürfen, wird der Netzwerker bereit sein, dem Frager einen ausreichenden Realitätssinn zu attestieren. Was allerdings nicht bedeutet, daß damit die Chancen für einen Termin gestiegen sind – es bedeutet nur, daß die Chance gestiegen ist, für jemand gehalten zu werden, der sinnvolle Fragen zu stellen in der Lage ist.
Der wirklich gefragte Repräsentant wird auch einen erst in Jahresfrist nahenden Termin nur unter Stirnrunzeln, verzweifeltem Kopfschütteln und ratlosem Brummen über die Zumutungen dieser Welt akzeptieren können. Wer so reagiert, ist mit Sicherheit unter den Herrschenden anzusiedeln – Grund genug für alle, die nicht baronisiert sind, aber es werden wollen und die Kriterien kennen, nicht eilfertig einzuräumen, daß sie für den kommenden Sonntag noch nicht ausgebucht sind.
VII.
Hat man mit Hilfe dieser Kriterien einen Baron ermittelt, kann man sich daran machen, weitere Akteure zu identifizieren. Das ist relativ einfach, weil man das Verfahren an statistischen Kriterien orientieren kann. Durch genaue Beobachtung der Kontakte und des Verhaltens des ausgekundschafteten Mitgliedes bekommt man schnell ein relativ zuverlässiges Gesamtbild der Angehörigen des Netzes. Die charakteristischen Züge sollen kurz zusammengestellt werden.
Die baroni haben keine gemeinsame Herkunft und keine gemeinsame Ausbildung. Landsmannschaftlich kommen sie aus allen deutschen Stämmen. Obwohl immer wieder der Verdacht beziehungsweise die interessierte Behauptung geäußert wird, sie seien überwiegend in Bayern geboren und aufgewachsen und schickten sich an, kumulativ die Macht in der Republik zu übernehmen, läßt sich diese These nicht belegen. Sie scheint eine Angstphantasie unterfinanzierter Wissenschaftler zu sein.
Die baroni gehören verschiedenen Glaubensgemeinschaften an, gelegentlich haben sie auch keine Religion. Denken und Argumentieren haben sie in den verschiedensten Wissenschaften gelernt. Sie stammen sowohl aus den Natur- als auch den Kulturwissenschaften. Selbst Ingenieure fehlen nicht. Die Vorstellung, die Biowissenschaften hätten, weil sie das Deutungsprimat der Philologen und Historiker abgelöst haben, auch im Netzwerk die Herrschaft übernommen, ist einstweilen noch unbegründet.
Alle Mitglieder des wissenschaftlichen Netzwerks kennen sich untereinander: Jedes Mitglied weiß, wer außer ihm noch Mitglied ist. Manche duzen sich, häufig nennt sich einer des anderen Freund und gelegentlich ist das sogar so gemeint, wie es im Alltag klingt. Aber in der Regel kennen sie sich nur aus ihren Funktionen und „Freund“ wird im Sinne von „Parteifreund“ verwendet. Sie fahren nicht miteinander in Urlaub. Sie gratulieren sich zwar zum Geburtstag, gehen gern und oft miteinander essen, halten einander einfallsreiche Reden, aber in ihren Träumen sehen sie sich nicht. Sie sind Geschäftspartner und gelegentlich Konkurrenten, ohne davon viel Aufhebens zu machen.
Die baroni sind Individualisten: Die Unterschiede zwischen den Netzwerkern, sei es im Charakter, sei es im geistigen Profil, sei es im Habitus, sei es im Gemüt oder in der Wäsche sind erheblich. Sie haben untereinander nicht jene fatale Ähnlichkeit der blauen Anzüge, rechteckigen Sicherheitskoffer und flotten Manieren, die die Manager von Weltunternehmen verwechselbar machen. Sie nutzen (anders als ihre Chauffeure) ihre Dienstwagen nicht als Statussymbol, sie haben keine Sicherheitsbeamten und werden sowohl in Biergärten, als auch in Konzerten, in Kinos und in Antiquariaten gesichtet. Sie haben zwar Visitenkarten, aber sie dienen sie ihrer Umgebung nicht an und geben sie nur auf Verlangen heraus. Sie sind eben individuelle, häufig individualistische „Führer“ und keine Japaner.
Die „Führer“ haben ihre Karriere nicht geplant: Von wenigen – deshalb meist ungeliebten – Sonderexemplaren abgesehen, wollte das einzelne Mitglied keineswegs in das Netzwerk aufsteigen. Zunächst waren die Akteure engagierte, nicht selten herausragende Wissenschaftler und sahen ihr Leben als Forscher in der Wissenschaft. Bis sie oder - häufiger noch - Fremde feststellten, daß sie auch anderes können; z.B. mit Politikern reden, einen Haushalt verstehen, einen Standpunkt durchfechten, ein Projekt evaluieren. Zunächst haben sie das für einen Teil ihrer Wissenschaft gehalten. Was auch nicht ganz falsch war. Aber allmählich ist die Wissenschaft zurückgeblieben und der Enthusiasmus ist auf dem Felde der Pragmatisierung sanft entschlummert.
Netzwerkangehörige reden gern von ihrem Rückzug. Sie drohen damit, wenn ihre Wünsche nicht in Erfüllung zu gehen scheinen. Aber sie kokettieren auch nostalgisch mit einer irgendwann stattfindenden Rückkehr in die Forschung. Allerdings gelingt dieses, gern als „Heimkehr“ bezeichnete, wissenschaftliche Comeback kaum jemals. Und wem sie gelingt, von dem läßt sich vermuten, daß ihm das „Wohnen auf der Brücke“, wie Lord Dahrendorf einst die wissenschaftspolitische Existenz genannt hat, nicht wirklich geglückt ist. Echte Brückenbewohner sind nicht mehr für das Ufer geeignet. Außerdem wissen sie, daß die am Ufer Verbliebenen die Rückkehrer nicht mit offenen Armen empfangen werden. Im Gegenteil. In der Regel wird dem Heimkehrer die erfolgreiche Abwesenheit heimgezahlt. Es wird ihm bedeutet, daß er seine Figuren brav und klaglos wieder auf Feld Null aufzustellen habe. Wer jahrelang andere gefördert hat, mag sich gefälligst jetzt selbst fördern.
Deswegen reden die baroni immer nur von ihrem Rückzug, aber sie fassen ihn nicht wirklich ins Auge.
Netzwerker können sich demgemäß nicht wirklich von ihrem Amte lösen. Wie überständige Politiker würden sie sich am liebsten niemals zurückziehen. Kommt es schließlich dazu, weil es das Alter, das Ende der Amtszeit oder einfach der Anstand verlangt, trifft sie das Ausscheiden aus der Klasse der Herrschenden in der Regel schwer. Auch wenn sie umstrittene Herrscher waren, so waren sie doch Herrscher. Jetzt umgibt sie gähnende Unwichtigkeit.
Die Weitsichtigen unter ihnen sorgen deshalb frühzeitig für warme Seniorate, elder statesmen-Positionen, von denen aus sich das allmähliche Verlöschen der Bedeutsamkeit ohne Anstrengung und harmonisch verarbeiten läßt. Notfalls bleiben Memoiren zur angemessenen Beschreibung ihrer früheren Bedeutung und zur beißenden Kritik an ihren unfähigen Nachfolgern.
VIII.
Was nicht sichtbar ist, läßt sich nur schwer entdecken. Vor dem Siegeszug der Naturwissenschaften war man überwiegend sogar der Meinung, das Unsichtbare sei nicht existent. Inzwischen sind wir eines besseren belehrt. Heutzutage beschäftigen sich die Naturwissenschaften nahezu ausschließlich mit Sachverhalten, die sich nur langsam einer aufmerksamen Beobachtung mit komplizierten Instrumenten und Experimenten erschließen.
Sozial- und Geisteswissenschaften haben, was die Beobachtung gesellschaftlicher Phänomene betrifft, diesbezüglich einen Nachholbedarf. Das rechtfertigt meinen Versuch, einige Kriterien zu nennen, mit deren Hilfe man sich unauffällig dem Ungreifbaren nähern kann. Die Zuverlässigkeit dieser Kriterien muß sich in der Praxis bewähren und auch dort erfahren werden. Das Experiment ist die Mutter der Erfahrung. Machen Sie ein Experiment!
mops-block
Baronessen und Barone
- Details