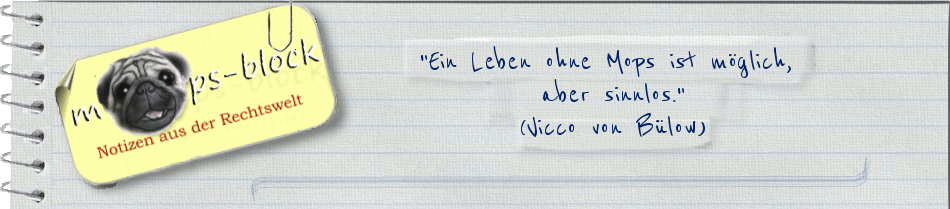Der Bildakt
(Ein Seminarprotokoll)
I.
14 genussvolle Lesestunden: Horst Bredekamp, Theorie des Bildakts (Suhrkamp 2010, 333 Seiten Text, mit Literatur und Namenregister 363 Seiten, viele Bilder, durchgängig viel zu klein als daß sie dem unbewaffneten Auge das zeigten, was der Autor in ihnen sah). Ein großartiges Buch. Vertieft zusammengewachsen aus den Früchten jahrelanger Studien. Strotzend vor immenser kunsthistorischer Kenntnis, stupender Überblick über die Geschichte der Philosophie, eindringliche Sprache, verwegene Rhetorik, gelegentlich trunken von Metaphern und Vergleichen („gleichsam“, „wie wenn“, „als ob“).
Ich schleppe das Buch ins Seminar und zwinge die Mitdenker fast 4 Stunden lang mit dem Gegenstand umzugehen, obwohl er nur am Rande zu unserem Thema (Medien des Rechts) gehört.
II.
Das Buch hat die Presse erreicht. 5 Rezensionen hat perlentaucher.de notiert (chronologisch: ZEIT, SZ, FR, FAZ, NZZ). Wir können nicht viel mit den Notizen anfangen. Viermal eher zurückhaltend bis negativ, einmal überschäumend positiv. Von Bredekamps Absichten erfährt man aus den Hinweisen nichts. Könnte sein, daß sich die Rezensenten nicht auf das Buch eingelassen haben, könnte auch sein, daß sie es nicht verstanden haben. Dümmliche Bemerkungen von der Art „Er klärt uns auf über uns“ (FR), deuten in diese zweite Richtung. Auch die mehrfache Rede von des Autors dunkler Sprache scheint eher die Dunkelheit in den Köpfen der Rezensenten zu dokumentieren. Kann freilich auch am Referenten der Rezensionen liegen, der vielleicht unbewußt nur das Belanglose notiert hat.
Wir schieben die substanzlosen Informationen beiseite und ich versuche, den dichten Text vorzustellen, wobei ich versuche, die Thesen des Autors, denen ich nicht folgen kann, so überzeugend wie möglich darzustellen.
III.
Die Hauptthese steht am Schluss des Buches und kommt deshalb zuerst: „Bilder sind nicht Dulder, sondern Erzeuger von wahrnehmungsbezogenen Erfahrungen und Handlungen“. Es geht also um die Erklärung, die Deutung und die Theoretisierung der Bild-Wirkung. Jeder kennt sie. Manche Bilder „sprechen uns an“, sagen wir nichtsahnend im Alltag. „Sagt Ihnen das Bild etwas?“ wurde ich schon oft gefragt. Aber ich weiß auch: Manche Bilder springen uns an, brennen, fressen sich fest, verfolgen uns, drehen sich hartnäckig hinter den Augen wie die Ohrwürmer in den Ohren.
Wie kommt das?
Liegt es am Bild oder liegt es an uns? Das ist, so Bredekamp, die entscheidende Frage, nämlich „ob den Bildern eine autonome Aktivität zugesprochen werden kann oder ob sie erst durch die handlungsstiftenden Aktivitäten der Benutzer zum Bildakt veranlaßt werden“ (49).
Es ist klar, daß die erste der beiden Möglichkeiten seine Option ist, denn die zweite entspricht doch sehr verschiedenen Optionen des main stream.
Schon taucht die erste Frage auf. Wo bleibt der Schöpfer des Bildes fragt sich Lars Otto*. Er wird hinweg gedacht, vermutet Regina Ogorek* und verweist auf die von den Juristen geschätzte „objektive Auslegung“ bei der der Gesetzgeber nur noch als Schemen und Auslöser eines Textes eine Rolle spielt.
Es wird genickt.
IV.
Tatsächlich ruht Bredekamps Blick nur auf dem Bild und dessen Wechselspiel mit dem Betrachter. Spielt es in dieser Konstellation „von sich aus eine eigene aktive Rolle“? (52) In immer neuen Wendungen und Perspektiven, bald als Frage, bald als Konstatierung, als Problem, als Paradox, als Selbstverständlichkeit, durchzieht dieses Thema in unaufhörlich changierendem Gewand das gesamte Buch.
Das „Phänomen der Eigenkraft der Bilder“ wurde bis ins 18. Jahrhundert „durch den Hinweis auf Gott oder eine metaphysisch in der Welt der Dinge wirkende, okkulte Instanz“ (56) erklärt, bestätigt Bredekamp was wir wissen. Vielleicht hätte die Aufklärung eine Antwort auf die Frage geben können, wie es kommt, „daß die Artefakte dem Menschen nicht nur als unabhängige, sprachfähige und mit einem Körper versehene Aktiva entgegentreten, sondern daß sie ihr Gegenüber zum Handeln bewegen und beeinflussen können“ (67) Aber die Aufklärung hat geschwiegen und sich dem „Grundproblem, wieso das Werk, obwohl geschaffen, beseelt zu sein scheint“ entzogen (84).
Es muß, sagt Bredekamp, und gibt damit einen vorläufigen, sich in der Folge weiter verdichtenden Wink, im Bild eine „Kraft“ stecken, „die dem Menschen auf eigenwillige und darin so anziehende wie verstörende Weise begegnet“ (85).
Diese „Kraft“ hat einen Namen: sie erscheint „als eine auf den Betrachter treffende enárgeia“ (85)
Nun ja – Energie. So sonderlich verschieden vom „Geist“, „Gott“ oder von der „Idee“ etc. scheint uns die Sache nicht zu sein.
„Animierung von Waffen“ ist eines der fast zahllosen Beispiele Bredekamps für „Beseelung“. Mir fällt Stanley Kubrick mit Ful Metal Jacket ein. „Mein Gewehr ist mein bester Freund“ müssen die Rekruten brüllen, nachdem sie der Waffe einen Mädchennamen gegeben und mit ihr ins Bett gegangen sind. Aber so weit brauche ich nicht abzuschweifen. Schließlich ertappe ich mich schon einmal dabei, daß ich meinen Computer beschimpfe, ihn als „Depp“ bezeichne und ihm die Schuld zuschiebe, wenn er nichts oder anderes als das Erwartete auf dem Schirm erscheinen lässt.
Immerhin handelt es sich bei Gewehr und Computer nicht um Bilder – könnte man meinen. Aber damit kommt man an Bredekamp nicht vorbei. „In seiner fundamentalen ersten Definition umfasst der Bildbegriff jedwede Form der Gestaltung“ (49), sagt der Autor und beruft sich hierfür auf Leon Battista Alberti (1404 – 1472, Architekt, Bildtheoretiker, Kryptologe). „Sowie Naturdinge ein Minimum an Spuren menschlicher Bearbeitung aufweisen“ gelten sie als Bild (35). Also auch der Faustkeil und das Schwert (Bredekamp), folglich auch das Gewehr und der Computer (Simon). Wenn die Produkte Signaturen tragen (früher: Paulus me fecit; heute: Heckler & Koch), dann lässt Bredekamp den Animierer spurlos verschwinden. Ihm erscheint „die Signatur als Selbstaussage eines Kampforgans“ (88).
W.H. Krauth* lacht.
V.
Wir grübeln über dem Satz: „Je genauer der Leser die Inschrift wahrnimmt, desto stärker führt sie in eine Sphäre, welche die Unterscheidung zwischen Betrachten und Handeln, Leben und Anorganik erschwert“ (89). Und stellen fest: Uns geht es nicht so. Das könnte an den Seminarteilnehmern liegen, die nicht recht nachvollziehen können/wollen, daß die „Ich-Sprachen, die sich in den Signaturen artikulieren […] eine dem Werk immanente enárgeia“ thematisieren (99). Bredekamp sagt dazu, die enárgeia sei von der Neuzeit als „Dingmagie und Okkultismus disqualifiziert“ und das „Problem in die Belletristik verbannt“ worden (99).
Alexander Lazović* wagt die These, die enárgeia sei Dingmagie und Okkultismus. Ich neige mehr zu Animismus. Aber das ist fast schon ein Schimpfwort.
Wir lassen die Frage offen und akzeptieren, daß sich zahllose Autoren „von agierenden Kunstwerken und Artefakten inspirieren“ ließen. Wir akzeptieren auch „das offenbar zu allen Zeiten und in jeder Kultur auftretende Empfinden, daß Artefakte, obwohl künstlich geschaffen, ein Eigenleben besitzen“ (99). Das „Empfinden“ besagt schließlich nichts. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen kann schließlich auch das „Empfinden“ nachgewiesen werden, daß es wenigstens einen Gott, vielleicht aber auch mehrere oder viele Götter gibt, geben müsse, ohne daß dies das Mindeste für einen Gottesbeweis hergeben würde.
Fragen wir uns lieber, was sich ändern würde, wenn wir akzeptieren, daß Bilder „autonom aktive Entitäten“ sind, daß „ein künstliches Gebilde zu leben und zu handeln vermag“ (165). Es wäre in der Tat nicht gerade wenig.
VI.
Gewiß, die Ersetzung einer „göttlich gestifteten Macht“ und die Vertreibung okkulter oder magischer Phantasien durch eine am Ende nicht weniger transzendente enárgeia scheint auf den ersten Blick noch kein großer Wurf zu sein. Denn schließlich gilt für alle diese „Kräfte“ in gleicher Weise, daß sie „sich kategorial einer Letzterklärung verschließen“ und lediglich beschrieben werden können (321f.). Wenn man jedoch darauf beharrt, daß die enárgeia ohne „metaphysischen Funkenschlag“, lediglich „aus sich heraus“, ins Leben geraten ist, dann muss der Materie notwendig das Prinzip des Lebens „von Beginn an inhärent sein“.
Ein raffinierter Schluss, mit dem Bredekamp hier Gott, Götter und Götzen mit einem Schlag verabschiedet:
Der klare Dual: Draußen oder Drinnen, plus abendländische Logik (entweder-oder) und die antimetaphysische Entscheidung: Nicht draußen. Also: drinnen.
Fehlt noch eine kleine Prämisse: in allem (statt: in manchem) Entstandenen ist Leben (schön definiert als: „ein mit Eigensinn versehenes Selbst, dem Selbstorganisation, Wachstum, Vermehrung, Zeitbezogenheit und Tod zuzuschreiben sind“), gut versteckt in der Frage, unter welcher Voraussetzung „die Materie für sich als tot definiert sein“ kann – fertig ist die petitio principii.
VII.
Für die Erkenntnistheorie hat diese Ausstattung der anorganischen Materie mit autonomem Leben erhebliche Konsequenzen. Denn die Epistemologie hat im Laufe des letzten Jahrhunderts, beginnend mit den ersten Zweifeln an der Geltung der Subjekt/Objekt-Spaltung bis hin zu dem radikal subjektivistischen Konstruktivismus, die Welt der Dinge immer weiter ins menschliche Gehirn verlegt und damit den alten Antagonismus von Materie und Geist in gewisser Weise sublimiert und konsumiert. Mit der Anerkennung „des bildaktiven Prinzips“ (322), der Überzeugung, daß Bilder „allein aus sich heraus zu sehen vermögen“ (249), daß sie „anorganisch und zugleich belebt“ (138) seien, und mit der nicht mehr metaphorischen Redeweise vom „Lebensrecht der Bilder“ (305) hat Bredekamp dieser Entwicklung eine pompöse Absage erteilt.
Tatsächlich handelt es sich bei Bredekamps Buch um den ersten Großangriff auf alle mit Nachahmung, Repräsentation, Konstruktion operierende Philosophie und Kunsttheorie, die der Kunstphilosoph beiläufig mit der Bemerkung abfertigt, es handele sich dabei um „Varianten der begrifflichen Entschärfung des objektiven Problems“ (100). Statt „objektiv“ wäre richtig: Bredekamps Problems, nämlich des „Grundproblems“: Das arte-factum, geschaffen und doch lebendig! (passim).
Würde man Bredekamp folgen, würde die vom menschlichen Gehirn aufgesaugte Dingwelt wieder aus diesem befreit und von neuem distanziert, „die lebendige Eigenkraft des Bildes“ könnte als Zeuge dafür aufgerufen werden, daß sowohl für die dinglichen Opfer des „Zerebralzentrismus“ als auch für das in der „Selbstfessel der Ichfixierung“ hängende Subjekt Erlösung möglich ist.
Daß dies keine von außen (mir/uns) an das verblüffende Buch herangetragene Interpretation, sondern das Programm des Autors ist, bestätigt er (ganz am Ende) selbst:
„Dies (scil. Lebensrecht des Bildes) bedeutet, jenen Sphärenverlust ungeheuren Ausmaßes zu überwinden, den die Moderne mit ihrer Privilegierung des Subjekts als Erzeuger und Halter der Welt produziert hat. Das Ich wird stärker, wenn es sich gegenüber der Aktivität des Bildes relativiert“ (328).
VIII.
Um dieses Programm zu erfüllen, hat Horst Bredekamp sein Buch geschrieben. Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein umfassender, eindringlicher und absolut faszinierender Streifzug durch Kunstgeschichte, Philosophie, Sprachwissenschaft von ihren Anfängen bis heute – immer auf der zeigenden, interpretierenden, zitierenden Suche nach Zeugnissen, Belegen, Nachrichten für die „lebendige Eigenkraft des Bildes“.
Will man sich gegen die These wenden, wird man kaum anders handeln können als dem Verfasser auf seinen voraussetzungsvollen Pfaden zu folgen, um das Material mit ihm auf seine Beweiskraft zu mustern.
Ein Weg, den das Seminar unverdrossen ging, denn es begriff den Weg als solchen schon als Genuss, weil er, ungeachtet der Kraft oder Schwäche des jeweiligen Arguments, eine Fülle von Lesarten, Deutungen, Einsichten zu bieten hat, die sich so leuchtend, originell und umfassend in kaum einem zeitgenössischen Kopfe finden werden.
IX.
Das ganze Material aus seinen Studien hat Bredekamp auf 6 Kapitel verteilt. Er beginnt (1) mit „Ursprünge und Begriffe“ und endet (6) mit der „Natur des Bildakts“.
Im ersten Kapitel werden zunächst der weit vom Gewohnten abweichende Bildbegriff nach Alberti und der Gedanke der enárgeia gerechtfertigt. Von Beidem war jetzt schon ausführlich die Rede.
Fehlt noch die Erläuterung des Ausdrucks „Bildakt“, dessen Verwandtschaft mit dem „Sprechakt“ von John L. Austin ins Auge fällt. Bredekamp berichtet, daß es bereits Versuche von Soziologen, Historikern und Künstlern gegeben hat, „die Theorie des Sprechakts für die Welt der Bilder zu nutzen“ (51). Henri Lefebvre („l’image est acte“) wird genannt, Philippe Dubois („acte iconique“), Gottfried Böhm („das Bild als Faktum und als Akt“), Jan Assmann, Hans Belting. In den Versuchen dieser Männer werde das Bild an die Stelle der Wörter gesetzt. Bredekamp möchte es an der Stelle des Sprechenden sehen und fragt, welche „Kraft das Bild befähigt, bei Betrachtung oder Berührung aus der Latenz in die Außenwirkung […] zu springen“.
Dieser Frage entsprechend wird der Bildakt definiert als „eine Wirkung auf das Empfinden, Denken und Handeln […], die aus der Kraft des Bildes und der Wechselwirkung mit dem betrachtenden, berührenden und auch hörenden Gegenüber entsteht“ (52).
Wirkung, Wirkkraft, Wirklatenz, Wirkmacht, Wirkmöglichkeit, enárgeia, potentia, Kraft, das sind die Begriffe, welche das Phänomen bezeichnen, das Bredekamp bei Dichtern, Denkern und Künstlern aufspürt.
X.
Den Reigen eröffnet Platon, der Bilderfeind, der in Höhlengleichnis und Politeia durch seinen „negativ gewendeten Respekt“ zugleich die Wirkmacht der Bilder anerkennt; Heidegger, der mit der Lebendigkeit eines Aquarells konfrontiert in der Frage verharrt, wie ein Werk ein Werk sein könne, wenn es sich keinem Auftrag verdankt und von keiner Öffentlichkeit wahrgenommen wird („finale Mutlosigkeit“); Lacan, der durch seine Deutung der Kunst als Filter gegen den Ansturm der blickenden Welt („nous sommes des êtres regardés“) den besänftigenden „Kunstwerken die fordernde Kraft“ entzieht.
Drei Beispiele für die artistische Virtualität mit denen Bredekamp den Bildakt in alter und neuer Philosophie ausfindig macht und seine ungenügende Reflektion rügt.
Kent Lerch* ist unzufrieden. Er hat den Eindruck, Präsuppositionen würden als Folgerungen ausgegeben. Nicken.
XI.
Um des Bildakts besser habhaft zu werden, isoliert Bredekamp drei Erscheinungsformen der Wirkkraft, die ihm dann als Bausteine für eine „bildaktive Phänomenologie“ dienen werden.
Schematischer Bildakt
„Schema“ bezeichnete in der Antike noch nicht eine Ordnungsform oder ein Muster, sondern einen (bevorzugt mathematischen) Körper, ein Körperbild, etwa von Kegel, Würfel, Zylinder etc. An diesen Begriff knüpft Bredekamp an, um den Bildakt zu bezeichnen, der sich durch die „instrumentell eingesetzte Verlebendigung des Bildes“ (simulierte Lebendigkeit) ereignet oder in der Aufführung eines lebenden Bildes (tableau vivant) geschieht.
Substitutiver Bildakt:
„Er entsteht durch den wechselseitigen Austausch von Körper und Bild in Religion, Naturforschung, Medien, Recht, Politik, Krieg und Bildersturm“(53). Bilder werden als Körper und Körper als Bilder behandelt, z.B., wenn bei einem Empfang der abwesende Kaiser als Bild auf dem Thron sitzt oder sein Bild vom Attentäter zerstört wird.
Intrinsischer Bildakt:
Der Bildakt „entzündet sich aus der Kraft der gestalteten Form als Form“ (53). Er ereignet sich „ohne jede zusätzliche Äußerungsform“, wovon etwa der Medusa-Mythos zeugt, nach dem der dem Bildblick schauend Begegnende versteinert. Bevor Außenminister Colin Powell im Un-Gebäude vor Picassos Antikriegsbild Guernica die amerikanischen Kriegsgelüste verkündete, ließ die amerikanische Delegation das Gemälde verhängen, um dem Bildblick zu entgehen, berichtet Bredekamp (233).
XII.
Für diese drei „Varianten des Bildakts“ gibt Bredekamp in seinem 2. Kapitel („Werkaussagen als Zeugnisse der Theorie“) gleichsam mit einem komprimiert-dreiteiligen Amuse-Gueule einen Vorgeschmack dessen, was er im Dreigang-Hauptmenu dem Leser zu servieren gedenkt.
Die inschriftlich mit Ichformen versehenen Figuren und Gefäße der Antike, die Signaturen und Selbstaussagen auf mittelalterlichen Bildern, Türen und Gerätschaften, die sprechenden Werke – Roms bekannteste Schmähsäule (Pasquino)¸ ein fiktiver Brief des Danziger Weltgerichtstriptychons von Hans Memling und die Schüsse von Niki de Saint Phalle auf ihre Gipsfiguren - dienen dem Autor als vorläufige Beglaubigung der Existenz des in drei Varianten erscheinenden Bildaktes, dessen Auftritte dann eingehend in den drei Hauptkapiteln [3. „Der schematische Bildakt: Lebendigkeit des Bildes“ (103 - 169); 4. „Der substitutive Bildakt: Austausch von Körper und Bild“ (171 - 230); 5. „Der intrinsische Bildakt: Form als Form“ (231-306)] vorgestellt werden.
XIII.
Die Seminarteilnehmer können sich nicht mehr in alles vertiefen. Die lebenden Bilder, die beseelten Automaten (Jaquet-Droz, Metropolis), der Komtur aus Don Giovanni und der liebestolle Pygmalion (der „schematische Bildakt in seiner Extremform“, 144) treffen noch auf neugieriges Interesse. Auch der substitutive Bildakt kann erst nach allerhand Anteilnahme die Bühne verlassen, zumal die Juristen hier zum Teil fachlich betroffen sind.
Der Widerspruch Bredekamps gegen die neuere Phototheorie, der die Juristen anhängen, indem sie die konstruktive Natur eines Fotos betonen und gegen eine Realpräsenz der fotografierten Objekte oder Personen polemisieren, kann uns nicht überzeugen. Bredekamps Behauptung, „die Annahme, im Bild eine körperliche Spur des Abgebildeten wirken zu sehen,“ sei „trotz aller Gegenbeweise nicht aufzuheben“ (190), wird mit dem Hinweis auf die Hartnäckigkeit auch manch anderer Gläubigkeiten pariert.
Roland Barthes Text „Bemerkung zur Photographie“ auf den sich der Autor beruft, ist nicht zur Hand, so daß der Beleg auf sich beruhen muss – meine spätere Nachprüfung ergibt, daß Bredekamp jedenfalls insofern einen (materialistischen) Bundesbruder gefunden hat, als dieser von einer physischen Emanation des (fotografierten) Referenzobjekts ausgeht, so daß die Fotografie nicht nur vergangene Wirklichkeit bezeugt, sondern sogar unvermittelte Wirklichkeit im Zustand des Vergangenen zeigen würde.
Von der antiken damnatio memoriae durch Verstümmlung der Münzbilder und Statuen über den byzantinischen Ikonoklasmus bis zum zeitgenössischen Sturz von Monumenten aller Art (Stalinstatuen nach dem Tauwetter, Buddhastatuen von Bamiyan, Saddam Hussein-Statuen nach dem Irakkrieg, Twin Towers am 11. Sept. 2001 etc.) wird der Bilderkrieg beschrieben, so daß die Feststellung: „die Vertauschung von Bild und Körper (wird) ubiquitär als Kriegsmittel eingesetzt.“(230) keinen Widerspruch findet.
XIV.
Mit dem Satz “während der schematische Bildakt auf dem Einschluss des Leiblichen in das Bild beruht und der substitutive Bildakt den Austausch zwischen Körper und Bild voraussetzt, wirkt der intrinsische Bildakt durch die potentia der Form“ (249) haben wir das letzte Kapitel dieses bildüppigen Buches aufgeschlagen. Eine gewisse Erschöpfung ist unübersehbar.
Die Metaphern des Autors „Die Augen der aus sich heraus blickenden Werke sind ihre Formen“ (249) wecken bislang verborgen gebliebene Verdrießlichkeiten. Seine ausgedehnten Prosopopoiien werden nicht mehr entschlüsselt und seine Philosophie des Punktes („Der Punkt definiert den Übergang vom Nichts zur Linie“) regt Sylvia Zahn* zu Betrachtungen über Objekt- und Metasprache an und Sabine Swoboda* versucht W.H. Krauth* klarzumachen, daß er nicht den Punkt beobachtet, sondern von einem Punkt angesehen wird. Als ich damit drohe die „Dynamis der Selbstüberschreitung“ in Punkt, Farbe und Raum ausgiebig zu referieren, drängen nicht nur die Teilnehmer sondern auch die verflossenen 4 Stunden zum Abschluss.
XV.
Das Bild spricht uns an und sagt uns etwas: daran halten alle fest; und an dem Umstand, daß diese Redeweise eine Metapher der Betrachter ist auch; und daß Bredekamp ihr zum Opfer fallen wollte, um seine Absicht der Rettung der Bilder in den Naturschutz einzufädeln.
Am Anfang seines Buches hat Horst Bredekamp seine Befragung der Bilder und Texte als ein „Gedankenexperiment“ bezeichnet, dazu angelegt herauszufinden, ob die Ergebnisse der Beobachtung der Eigenkraft der Bilder „einem Zirkelschluß oder einer treffenden Phänomenbestimmung entsprungen sind“ (56). Wir einigen uns auf Zirkelschluss.
Aber es ist der schönste Zirkelschluss seit Jahrzehnten.
Die mit * bezeichneten Personen waren Seminarteilnehmer
AM TAG DANACH
W.H. Krauth (Wissenschaftsdirektor der BBAW) schickt „einige systemtheoretische, bewusst orthodox formulierte Überlegungen zu dem, was Herr Simon über Bredekamps Bildakte referiert hat“.
So sehen sie aus:
Einige Anschlussüberlegungen zum Bredekamp-Referat von D. Simon
Der sozialevolutionär frühe Animismus sagt, alle Objekte sind belebt, mit Absichten, Zielen, Handlungsfähigkeit ausgestattet. Man muss sie beherrschen, bannen.
Das Christentum versteht Natur als die Artefakte Gottes. Manche leben; nur eines kann sich selbst beobachten. Aber alle haben Bedeutung. Gott will uns mit ihnen etwas mitteilen. Deshalb kann und soll die selbstreflexive Natur Mensch in der Beobachtung der Dinge die Pläne Gottes entdecken.
Mit der Aufklärung wird Gott als Erkenntnishorizont gestrichen und unter der Prämisse fortgefahren, man könne und solle den Naturdingen ihre geheim gehaltenen / latenten Informationen entlocken, sie durch geeignete Methoden zur Preisgabe von Mitteilungen zwingen (Hobbes).
Bilder (und ohne den weiten Bildbegriff auch anderes) sind Artefakte des Menschen.
Man kann in beiden Richtungen an die o.g. Tradition anschließen und fragen:
- Welche Informationen will der Produzent durch das Artefakt mitteilen?
- Welche Informationen will uns das Artefakt mitteilen?
In beiden Fällen bleibt der so fragende Beobachter unbeobachtet. D.h. unbeobachtet bleibt die Einheit der Unterscheidung von Information | Produzent/Artefakt. Die nämlich ist der so unterscheidende Beobachter selbst, der durch das Absehen von sich selbst, Fragen und ihre Beantwortung durch das Objekt überhaupt erst möglich macht. Er rechnet sich die Unterscheidung nicht als Handeln zu, sondern erlebt sie als „Welt“.
Nichts kann uns (mit Bredekamp) daran hindern auszuprobieren, wie weit wir kommen, wenn wir fragen, was uns ein Artefakt mitteilt. Freilich muss geklärt werden, was es bedeutet, die Frage so zu stellen. Und welche Art von Antworten man bekommt.
Die Systemtheorie liefert zwei wichtige Hilfsmittel zum Verständnis, die ich bereits verwendet habe:
- Zum einen die Unterscheidung von Erleben und Handeln. Wer beobachtet erlebt, dass er erlebt! Wer den Beobachter beobachtet, erlebt, dass dieser handelt (d.h. seine Beobachtung in ganz bestimmter Weise instrumentiert).
- Zum anderen das hinter dieser Beschreibung steckende Konzept der Zurechnung. Die jeweils zu beantwortende Frage ist, welchen Verursachern die Beobachtungsergebnisse zugerechnet werden.
Dafür stehen in der Regel drei Kandidaten bereit:
- das Objekt selbst
- eine das So-Sein des Objektes bewirkende causa
- der Beobachter.
Wenn der Beobachter ein Objekt beobachtet, „erlebt“ er, d.h. er rechnet die Ergebnisse seiner Beobachtung dem Objekt zu. Dies gilt auch dann, wenn er mithilfe einer Theorie beobachtet, die ihm bedeutet, die Merkmale des beobachteten Objekts müssten ‚in letzter Instanz‘ den zugrunde- oder „hinter dem Rücken“ liegenden Ursachen zugerechnet werden.
Dies gilt für jede Beobachtung, auch für eine Beobachtung zweiter Ordnung!
Allerdings beobachtet eine solche Beobachtung zweiter Ordnung den Beobachter als Handelnden, d.h. sie rechnet ihm die Konstituierung des Objektes durch die von ihm benutzten Unterscheidungen zu. Beobachter erster und zweiter Ordnung können selbstverständlich dieselbe Person sein. Aber nur in zeitlicher Folge! D.h. der jeweilige Beobachtungsprozess bleibt blind für sein Handeln, er erlebt, welche Informationen die Dinge über sich mitteilen.
Die Kopplung von Erleben und Handeln und die korrespondierende Zurechnung auf das Objekt bzw. den Beobachter ist unvermeidlich und nicht zu umgehen. Sie gegeneinander auszuspielen und für eine Seite zu optieren, ist ebenso wenig sinnvoll, wie die Dialektik zu beschwören. Das haben auch der Konstruktivismus und der Dekonstruktivismus zur Kenntnis zu nehmen: Der Aschermittwoch, an dem alle Masken fallen, findet nicht statt!
Gleichwohl bilden sich, wie wir alle wissen, in sozialen Systemen aufgrund wiederholter Beobachtungs- und Kommunikationsvorgänge für die meisten Objekte nicht mehr weiter befragte sozial stabile Unterstellungen über die Einheit und Eigenschaften eines Objektes heraus; oder mit anderen Worten, über die Informationen, die das Objekt über sich mitteilt, weil wir sie erleben und dem Objekt zurechnen. Diese Unterstellungen bestimmen als Wissen / Erkenntnisse unsere (auch wissenschaftlichen) Alltagsüberzeugungen und wie wir mit dem Objekt umgehen. Auf ihrer Grundlage lassen sich sozial legitimiert weitere Beobachtungen anstellen und neue Erkenntnisse über Objekte erwerben. Allerdings bleibt dieses Wissen grundsätzlich der Beobachtung zweiter Ordnung ausgesetzt und wenn es in der sozialen Realität Prämien darauf gibt oder sie zumindest nicht entmutigt wird, dann stellt sie sich auch ein.
Insoweit kann man mit Bredekamp also durchaus die Frage nach den Mitteilungen des Objektes stellen; Forschung macht das zu ihrem Alltagsgeschäft. Unfruchtbar sind allerdings seine Exaltiertheiten.
Etwa die Zuschreibung von Leben an „Bilder“. Sie bleibt vor dem Hintergrund eines hinreichend informativen, d.h. unterscheidungsfähigen Begriffs von Leben hoffnungslos metaphorisch (weshalb Hinweise auf Blumenberg nicht einschlägig sind). Das mag denjenigen schmerzen, der wie Bredekamp kulturell bedeutenden Artefakten (denn um alle kann es nicht gehen, schon weil sich die Welt sonst in ihr eigenes Archiv verwandeln müsste) einen unbedingten Schutz gewähren will. Aber wahrscheinlich lässt sich mit weniger Aufwand an Imagination als Bredekamp selbst getrieben hat, eine andere Lösung finden als die Belebung der Objekte - wenn man das denn überhaupt will.
Oder dem Bild die Mitteilung einer Aufforderung zuzurechnen. Nur weil Artefakte mit Bewusstsein gemacht sind, folgt nicht, dass sie auch Bewusstsein besitzen. Es ist weder nötig noch fruchtbar, die Erlebensqualität der Beobachtung in quasi-animistischer Weise der Absicht des Objekts zuzuschreiben, d.h. ihm bewusste Mitteilungsabsichten zu unterstellen. Dies tun wir bisher mit gutem Erfolg nur in Fällen von reflexiven, mit Bewusstsein ausgestatteten Objekten. Und Bilder zählen nicht dazu. Dass ein Objekt zur Beobachtung auffordert, heißt einfach, dass ein Beobachter sich zur Beobachtung entschlossen hat und er sein Beobachten als Erleben erlebt. Bredekamp findet und zitiert eine Vielzahl von Beispielen für diese Redeweise; nicht ohne Grund: so erlebt ein Objektbeobachter eben. Allerdings wird ein Beobachter der Szene befinden, dies sei schon deshalb eine uneigentliche Redeweise, weil der Beobachter erst durch seine Unterscheidungen darüber entscheidet (d.h. er handelt), was das Objekt ist. Wenn wie im sozialen Alltag üblich nicht jeder Beobachter eine ganz spezielle eigene Objektkonstruktion vornimmt, liegt das nicht daran, dass das Objekt seine Grenzen selbst bestimmt und absichtsvoll mitteilt oder mitgeteilt hätte, sondern an den in der vorgängigen Kommunikation ausgebildeten sozial geteilten Erwartungen an das Objekt. Wenn sich im Laufe weiterer Beobachtungsprozesse herausstellt, dass das Objekt diesen Erwartungen nicht entspricht oder weitere zusätzliche Eigenschaften zeigt, so kann daraus ebenfalls nicht auf die Selbstkonstitution des Objektes geschlossen werden, sondern nur darauf, dass anderes Handeln zuweilen anderes Erleben zur Folge hat.
Es bleibt also dabei: Erkenntnis, auch die von Bildern, oszilliert immer zwischen Erleben und Handeln und bringt so das grundsätzlich wandelbare Wissen über die Welt hervor.
Wolf - Hagen Krauth
mops-block
Seminar mit Bredekamp
- Details