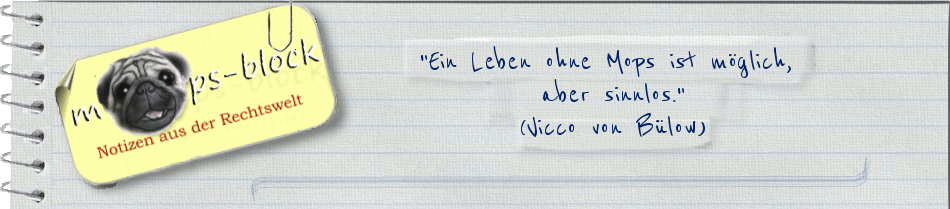Assistentinnen haben die Aufgabe, diejenigen, denen sie assistieren, vor Misshelligkeiten zu bewahren, sie auf ihre beschränkte Kapazität diskret hinzuweisen und Wissens- und Bildungslücken effektiv aufzufüllen bzw. zu verhüllen. Außerdem sollte der gute Assistent sich die unauffällige Aufklärung des Assistierten angelegen sein lassen. Vera Finger ist in dieser Beziehung unermüdlich und schreibt mir folgendes:
That shit ain't right
Angesichts der Banalitäten und Anti-Qualitäten, die mehrheitlich das Fernsehprogramm bestimmen, möchte ich auf ein Wunder hinweisen: Das TV-Format ermöglicht von Zeit zu Zeit wahre Diamanten der Erzählung. In diese Kategorie wird jedenfalls einhellig die US-amerikanische TV-Serie „The Wire“ eingeordnet. Als dem Fernsehen eher distanziert gegenüberstehend, stimme ich diesem Urteil etwas verspätet, aber restlos überzeugt und in grenzenloser Begeisterung zu.„The Wire“ spielt in Baltimore, Maryland, USA, einer Stadt unweit des Regierungssitzes Washington D.C. gelegen und mit vielen Spitznamen versehen – Baltimorgue; Bulletmore; Bodymore, Murderland.
Über fünf Staffeln und sechs Jahre hinweg (2002-2008) erzählte The Wire das Leben und Sterben dieser Stadt. Die Einschaltquote war mies, die Rezensionen hingegen überschlugen sich vor Lob und tun dies bis heute. Warum? Die Serie ist von David Simon geschrieben worden, der 10 Jahre lang als Polizeireporter in Baltimore gearbeitet hat. Wer die Bilder von Weegee, dem ersten US-Pressefotografen, der offiziell den Polizeifunk abhören durfte und entsprechende Szenen vor die Linse bekam, wer dessen Bilder aus dem New York der 30er und 40er Jahre kennt, der hat einen ersten stillen Eindruck von dem, wovon Simon lange Zeit später erzählt. Straßen, Drogen, Waffen, Dealer, Gerichtssäle, Kameras, Politiker, Boxkämpfe, Zeitungen, Gefängnisse, Polizisten, Kinder, Basketball, Leichen. Geld. The Wire bewegt diese Bilder. In den Straßen und Gerichtssälen, überall handeln Menschen. Ihr Alltag besteht aus Alltäglichkeiten: Autofahren, Kaffeetrinken, Sex, kein Sex, Schnapstrinken, Telefonieren, Essen, Schlafen. Vielleicht haben viele TV-Zuschauer damals 2002 nach der ersten Folge von The Wire befunden, dass dieser Alltag langweilt und nicht weiter sehenswert ist, zumal er im postindustriellen, überaus unspektakulären und in weiten Teilen hässlichen Baltimore stattfindet.
Nach der ersten Staffel weiß man dann zumindest: In eben dieser öden Stadt tobt ein Drogenkrieg. Die Polizei startet permanent neue Versuche, sich über Abhörmaßnahmen in das Kommunikationsnetz der Dealer einzuklinken. Damit hat man die ersten zwei Gruppen vorgestellt bekommen, die in dieser Stadt handeln. Man lernt einige Charaktere kennen, es sterben welche. Die zweite Staffel spielt fast ausschließlich im Hafengelände von Baltimore. Man lernt weitere Gruppen kennen, viele Charaktere der ersten Staffel treten in den Hintergrund, einige laufen weiter mit, es kommen neue hinzu. Die dritte Staffel kehrt vom Hafen wieder auf die Straßen zurück. Drogenkrieg reloaded, in Variation und Weiterführung der Geschehnisse aus der ersten Staffel. Es wird wieder gestorben. Und spätestens jetzt macht es auf einmal „klick“ und man versteht, was man in The Wire sehen kann. Es ist das Ganze und der Einzelne.
The Wire zeigt alles: Die Gesellschaft, das System, Subsysteme, Automatismen, Zirkulationen. Strukturen und Akteure, einige herausragende, wechselnde Hauptcharaktere und viele, viele weitere Schauplätze. Den Witz, der Situationen und Menschen innewohnen kann. Man muss herzhaft lachen, an einigen Stellen. Die Angst, die Menschen überfällt. Versuche, sich zu ändern. Ausbrüche aus familiären Zwängen, aus sozialen Klassen. Versuche, Institutionen zu überlisten und Umstände zu ändern. Sie alle scheiden sich an Automatismen und Ordnungsmaßnahmen, und sie scheitern in den allermeisten Fällen, spätestens wenn Bundesbehörden sich einschalten.
All diese Erzählungen werden von Sprachen begleitet, die auch für US-amerikanische Muttersprachler herausfordernd sind: Der Slang der Drogendealer findet sich noch teilweise im Plausch der Streifenpolizisten wieder, die Staatsanwältin transferiert deren Ermittlungsergebnisse in den Gerichtssaal und die Stadtratsabgeordneten präsentieren sich mitsamt Kriminalitätsstatistik in einem polierten Sprachgewand, das an die Wortwahl der PR-Beraterin aus Washington anknüpft, hingegen mit den Straßen von Baltimore scheinbar nichts mehr gemein hat. Weisheiten werden aber auch dort gesprochen: „The game is the game“, so verkündet einer der Dealer mit Schulterzucken. Ein anderer Dealer, dessen kleine Karriere man als Zuschauer seit der ersten Staffel begleitet hat, entscheidet sich später für seinen Ausstieg aus „the Game“. Was für ihn bedeutet, dass er keine Lust mehr auf den Drogenkrieg hat, der wieder einmal brutalst eskaliert. Er liefert auch eine Begründung für seine Entscheidung, das ihm bisher bekannte Spiel zu quittieren:
„This shit ain't right.“
Er wird erschossen. Das Spiel geht weiter. The Wire basiert auf Beobachtungen, deren Wahrheit so ehrlich und präzise gezeigt wird, dass es schmerzt. Der Schmerz lohnt sich.
mops-block
The Wire
- Details