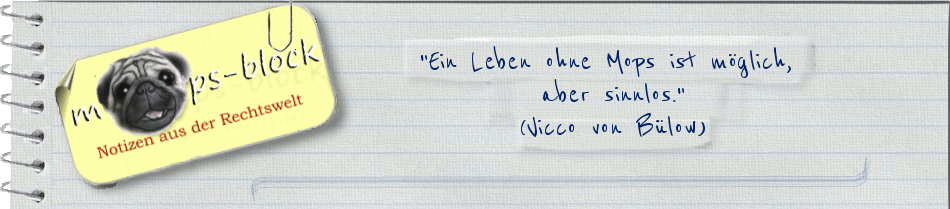Robert Menasse hat ein neues Buch geschrieben. Die Hauptstadt. Nicht das, von dem Sie seit Monaten gehört, das Sie vielleicht schon gelesen haben. Für das ihm im Herbst 2017 der Preis des Deutschen Buchhandels verliehen wurde. Also nicht das vielgelobte Buch, in dem er mit der Phantasie des Roman-Autors, aber auf der Grundlage langjähriger vor-Ort-Recherchen ein gleichermaßen fiktives wie beklemmend plausibles Brüsseler Szenario zeichnet: Auch wenn es nicht so war, hätte es jedenfalls so gewesen sein können.
Robert Menasse hat ein neues Buch geschrieben. Die Hauptstadt. Nicht das, von dem Sie seit Monaten gehört, das Sie vielleicht schon gelesen haben. Für das ihm im Herbst 2017 der Preis des Deutschen Buchhandels verliehen wurde. Also nicht das vielgelobte Buch, in dem er mit der Phantasie des Roman-Autors, aber auf der Grundlage langjähriger vor-Ort-Recherchen ein gleichermaßen fiktives wie beklemmend plausibles Brüsseler Szenario zeichnet: Auch wenn es nicht so war, hätte es jedenfalls so gewesen sein können.
1. Die Vielzahl der darin ausgeworfenen Handlungsstränge, raffiniert verwoben, aufgenommen und wieder fallen gelassen, hat eine erzählerische Mitte. Die EU, genauer die Europäische Kommission, noch genauer das Kulturressort und das dort angesiedelte Projekt einer Jubiläumsfeier zu Ehren der Kommission, um anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens ihr Image aufzupolieren. Nicht zu Unrecht wurde deshalb Menasses Buch von etlichen der zahlreichen meist überschwänglichen Besprechungen als erster eigentlicher Europaroman aufgenommen, wobei die meisten Rezensenten der Einschätzung zuneigten, der Autor habe ein proeuropäisches Buch geschrieben. Ich habe das Buch vor kurzem gelesen und teile diese Auffassung. Zwar möchte man in vielen Fällen über die mittels der handelnden Personen beschriebenen 'Verhältnisse' (Kommunikations- und Machtstrukturen, Techniken und Hierarchien) meist eher weinen als lachen, aber es wäre eine grobe Verkennung, aus den wunderlichen Geschehnissen im bürokratischen Paralleluniversum vornehmlich den ironischen Blick des Europaskeptikers herauszulesen und nicht auch den distanzfähigen und gleichzeitig überzeugten Anhänger der Idee eines supranationalen Friedensprojekts.
Umso mehr ist man erstaunt, wenn man von einem anderen Menasse-Buch erfährt, einem ideologietriefenden, wahnhaften Machwerk, das Gegenstand einer von Roland Freudenstein verfassten Rezension ist, die am 12. 1. 2018 unter dem Leitmotiv „Wie Robert Menasse Europa kaputtschreibt“ im Berliner Tagespiegel veröffentlicht wurde. Dieses zweite Buch, zeitgleich wie das erste erschienen, heißt übrigens auch Die Hauptstadt, doch kann es sich unmöglich um die erwähnte Meistererzählung handeln, zumindest scheint es unvorstellbar, dass der Rezensent dasselbe Hauptstadtbuch gelesen und besprochen hat, das der Meinungsbildung der übrigen Öffentlichkeit zugrunde liegt. Da Freudenstein aber vorgibt, genau das zu tun, also über jenes preisgekrönte Werk und nicht etwa über ein anderes zu schreiben, bzw. dazu eine „politische Kritik“ vorzulegen, soll der Sache etwas genauer nachgegangen werden.
2. Wer antritt, einen Roman politischer Kritik zu unterziehen, unternimmt etwas, das der Erläuterung bedarf. Geht er doch von der keineswegs unproblematischen Prämisse aus, dass der Autor seine Figuren nur sprechen und handeln lässt, um dem Leser eine bestimmte politische Überzeugung, nämlich die des Autors, nahezubringen. So etwas gibt es; das Genre des politischen Romans ist seit langem etabliert. Bei einem Buch mit etlichen höchst komplexen Abläufen und zahlreichen Hauptpersonen mit ganz unterschiedlichen biographischen und politischen Verortungen wäre allerdings bereits die Entscheidung darüber, wodurch bzw. durch wen welche Autorenbotschaft vorgetragen wird, kaum zu treffen. Wenn also die „politische Kritik“ Freudensteins sich nicht generell auf eine latente Europafreundlichkeit Menasses beziehen soll – dagegen spricht allerdings der Titel der Rezension – wüsste man gern, wo er Indizien für eine dem Buchautor persönlich zurechenbare und aus des Rezensenten Sicht kritikwürdige politische Positionierung entnommen haben will und vor allem, um welche Botschaft es sich handelt.
Freudenstein muss die Fallstricke seines Ansatzes zumindest erahnt haben und versucht daher bereits im ersten Satz einen Befreiungsschlag. Er startet nämlich mit der eigenwilligen These: „‘Die Hauptstadt‘ ist kein Roman, es (sic!) ist ein Manifest. Ein absurdes. Dass es in Deutschland zum Bestseller wurde, macht mich fassungslos.“ Aha, ein Manifest also. Das eignet sich natürlich sehr viel besser für die angekündigte „politische Kritik“. Mag sich Menasse noch so penetrant als Romanautor verkleidet, Suhrkamp ihn dabei noch so auflagengierig unterstützt haben – der Rezensent hat sich nicht täuschen lassen. Für ihn gilt: Wo Roman draufsteht, ist noch lange nicht Roman drin. Sondern eben Manifest. „Daran muss es sich messen lassen.“

Wem die Umtaufe nicht auf Anhieb einleuchtet (mir, zum Beispiel), bekommt vom Umtäufer eine Denkhilfe. Den Hinweis auf die berühmte Pfeife des belgischen Surrealisten Magritte. Die ist bekanntermaßen mit dem Satz unterschrieben: Ceci n´est pas une pipe – soll heißen: Das Ding sieht zwar aus, wie eine Pfeife, ist aber keine, sondern kommt (als Abbildung) nur im Gewand der Pfeife daher. So müsse man sich das auch bei dem angeblichen Roman von Menasse vorstellen. Er ist keiner, kommt aber so daher.
In Wahrheit handelt es sich um ein politisches Statement, dem das Gewand eines Romans übergeworfen wurde. Eine trickreich eingefädelte, vom Verlag unterstützte Lesertäuschung, gewissermaßen Ideologie unter Vollverschleierung. Deshalb wäre als Untertitel angebracht gewesen: Ceci n´est pas un roman. Mit heuchlerischem Wohlwollen wird der Umdeutungsprozess dann noch mit einem vergifteten Kompliment garniert: „Anerkennenswert ist …Menasses Versuch, die Europäische Union quasi in Romanform zu gießen.“ Vergiftet deshalb, weil wir ja schon erfahren haben, dass der „Versuch“ gescheitert ist.
3. Nach diesem Aufschlag kommen die Inhalte an die Reihe. Aus ihnen soll sich die Berechtigung für die Umdeutung ergeben. Die zentrale „Botschaft“, die Freudenstein dem „Manifest“ entnimmt, lautet: „Nationalismus endet zwangsläufig im Holocaust.“ Das wäre – insbesondere im Kontext „zwangsläufig“ – in der Tat eine gewagte Verallgemeinerung sehr spezifischer historischer Erfahrungen, für die sich vielleicht einige Plausibilität, aber sicher nicht zwingende Argumente anführen ließen. Deswegen will man wissen, wieso der Rezensent glaubt, gerade diese Botschaft dem Text als Leitmotiv – und zwar des Autors – entlocken zu können.
In Menasses Buch gibt es ein gutes Dutzend Akteure, um die herum sich die verschiedenen Erzählstränge ranken. Das obige Credo findet sich so nirgendwo, aber immerhin gibt es eine Figur, die sich intensiv mit Auschwitz beschäftigt: Martin Susman, Mitglied des Ressorts Kultur, der befürchtet, das Jubiläumsprojekt zu Ehren der EU-Kommission, dessen Planung ihm obliegt, könne in einer Anhäufung klischeehafter Festtagsrituale versacken. Er hat deshalb den Einfall, dem Anlass dadurch eine besondere Würde verleihen zu können, dass man die EU-Kommission als Vollstrecker einer supranationalen Friedensidee präsentiert, auf die sich ehemals kriegsbeteiligte Länder Europas vor dem Hintergrund der gerade überwundenen Nazigräuel verständigt haben. Zugespitzt: Die Erfahrung von Auschwitz als Gründungsidee Europas. Die Ressortchefin, eine Zypriotin mit Ambitionen, findet die Idee apart, sieht eine Chance, ihre eigene Karriere mit dem gelungenen Management eines ausgefallenen Projekts zu fördern und gibt grünes Licht. Für Freudenstein genug, um daraus „die zentrale Botschaft“ des Manifests freihändig zu extrapolieren: „Die einzig passende Antwort auf Auschwitz ist die Europäische Republik“, also die „Überwindung der Nationen in einem europäischen Staat, der auf den Grundrechten seiner Bürger basiert und dessen Avantgarde die Europäische Kommission in Brüssel ist.“
Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, könnte man meinen – hat allerdings weder mit der europäischen Gegenwart noch mit der absehbaren EU-Zukunft etwas zu tun. Mit dem Hauptstadtroman von Menasse allerdings ebenso wenig, und das gilt auch für die gleichfalls dem Buch abgelauschte Formel „Mehr Europa! als Antwort auf alle (sic!) Probleme des Kontinents.“ Der Melancholiker Susman lässt zwar seine Gedanken ab und zu um diese Stichworte kreisen, ist sich aber seiner Sache keineswegs sicher, vielmehr von Schwermut und Selbstzweifeln gepeinigt und letztlich erfolglos. Das Projekt scheitert auf wunderbar europäische Weise an den unterschiedlichsten Interessenkonflikten und wird von niemandem beweint – auch nicht von Susman. Als Verkünder manifesttauglicher Positionen wäre er also schon rein typologisch eine denkbar schlechte Wahl. Mit der gleichen Plausibilität ließe sich behaupten, Thomas Mann habe im Zauberberg mit der Stimme Settembrinis seinen politischen Fortschrittsglauben zu Protokoll geben wollen.
4. Findet sich also für den Bogen vom Nationalstaat über Auschwitz zur Europäischen Republik wenig Interpretandum, spielt auch im Weiteren der Textbezug kaum eine Rolle. Da wird vorlagenfrei von Menasses (!) Plädoyer für eine schuldenfinanzierte Umverteilung gehandelt, von seiner (!) Diskreditierung Andersdenkender als Lobbyisten, von seinen (!) antiamerikanischen Ressentiments, seiner (!) Dämonisierung von Teilen Mitteleuropas und seinem (!) „politisch korrekten Appeasement gegenüber dem Islamismus“. Letzteres ist am Erstaunlichsten, weil Islam oder Islamismus im Buch nicht einmal am Rande vorkommen, was Freudenstein freilich nicht anficht. Im Gegenteilt: er wittert Mimikry! Die Figur eines polnischen „christlichen Killers“ habe Menasse offenbar nur erfunden, um Teile Mitteleuropas zu dämonisieren und dem Leser nahezubringen, dass religiös motivierte Gewalt nicht nur im Islam ihre Wurzeln hat. Man muss schon sehr verquer denken, um diese Beweisführung aus dem Buch herauszulesen. Aber Freudenstein hat eine Erklärung für alle seine Entdeckungen: Bei Menasse habe „der Wahnsinn Methode und eine politische Funktion, denn er ist integraler Bestandteil seines Manifestes.“ Wenn der Autor einen ehrlichen Brüssel-Roman hätte schreiben wollen, wäre über andere Dinge zu berichten gewesen, z.B. über „jede Menge dschihadistischer Terroristen, in den letzten Jahren auch in Molenbeek, einem Brüsseler Stadtteil. Einen Terroranschlag aber schiebt Menasse nur lustlos auf den letzten Seiten ein. Alles, was im wirklichen Leben relevant ist – an polizeilicher Schlamperei, falsch verstandener Toleranz und fataler Multikulti-Ideologie und heute nun einmal einen beträchtlichen Teil der Brüsseler Realität ausmacht, kommt bei Menasse nicht vor.“ Aber Ehrlichkeit wird nicht geboten: „Robert Menasse täuscht Offenheit vor und bietet doch letzten Endes ein fest geschlossenes, links-westeuropäisches Weltbild.“
5. Das Absonderliche einer Kritik, die sich darüber beklagt, dass ein Romanautor hinsichtlich seiner Gegenstände nicht die Wunschliste des Kritikers abgearbeitet und auch die Gewichtungen nach eigenem Gusto vorgenommen hat („Terroranschlag…lustlos auf den letzten Seiten“), mag Freudenstein über seinem ganzen Ärger entgangen sein. Die Enttäuschung darüber, dass Menasse nicht den Brüssel-Roman geschrieben hat, den Freudenstein gern gelesen hätte, erklärt seinen Furor aber eigentlich nicht. Erklärungsträchtiger ist da schon das fest geschlossene, links-westeuropäische Weltbild, das Freudenstein glaubt, aus der Romanhandlung herauslesen und als politische Botschaft dem Autor zurechnen zu können. Der jahrelange Mitarbeiter der Konrad Adenauer Stiftung und spätere Stellvertretene Direktor der parteinahen Stiftung der Europäischen Volkspartei in Brüssel, zudem Leiter der Kommission zur Formulierung des neuen Grundsatzprogramms der EVP hat in Menasse offenbar den politischen Gegner erkannt, der nicht davor zurückschreckt, seine „absurde“ Ideologie nun auch noch in das populistische Format eines „Bestsellers“ zu gießen. Mit anderen Worten: Der Europa kaputtschreibt.
Das wirkt zwar etwas paranoid, erklärt aber den Ingrimm. Nicht erklärt ist hingegen, weshalb Freudenstein seine politische Kritik auf Rekonstruktionen aufbaut, die dem kritisierten Buch beim besten (oder schlechtesten) Willen nicht entnommen werden können.
Einen Fingerzeig gibt eine Passage im Anschluss an Menasses vermeintliche Forderung nach Überwindung der Nationalstaaten und Gründung einer Europäischen Republik. Diese seine ‘Rekonstruktion‘ ergänzt Freudenstein mit einem zornigen Statement: „Genau das hat auch die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike Guerot 2016 und 2017 in zwei Büchern gefordert: ein Markt, eine Währung, eine Demokratie…“. Ich habe nicht im Einzelnen überprüft, ob Guérot das wirklich gefordert hat – Menasse hat es in seinem Hauptstadtbuch jedenfalls nicht getan. Bei Freudenstein sind aber – ohne dass man den Grund dafür erfährt – Menasse und Guérot zur literarisch-politischen Einheit zusammengeschmolzen, mit der Folge, dass die Thesen Guérots kurzerhand in das Hauptstadtbuch hineingelesen werden. Und dementsprechend wird die Verantwortung verteilt. Was für Guérot gilt, gilt auch für Menasse. Wenn die eine unliebsame Bücher schreibt, kann der andere seine Hände nicht in Unschuld waschen. Sogar ein an Guérot adressierter Journalistenkommentar zu einem ihrer Bücher (Thomas Schmid, ehemaliger Herausgeber der Tageszeitung „Die Welt“: Man muss Europa auch vor seinen Freunden schützen) wird kurzerhand in Freudensteins Menasse-Kritik eingebaut, geradeso, als hätte auch der Journalist Guérot gesagt und (zumindest auch) Menasse gemeint.
6. Dafür spricht nichts. Wohl aber beginnt die Idee, Freudenstein habe ein ganz anderes Buch besprochen als den Hauptstadtroman, Gestalt anzunehmen. Und ein Blick ins Internet bestätigt die Vermutung: Robert Menasse und Ulrike Guérot haben sich tatsächlich einmal literarisch verbunden, und zwar – man ahnt es – zu einem politischen „Manifest zur Gründung einer Europäischen Republik“. Im April 2013. Es enthält ein Plädoyer für ein anderes Europa auf der Grundlage einer europäischen Demokratie, deren nachnationale Kompetenzordnung die Basis für die Lösung der gemeinsamen Zukunftsprobleme werden soll.
Freudenstein hat also keineswegs frei erfunden. Er hat nur beide Bücher zusammengefügt, das Manifest von 2013 – Guérot spricht später einmal von einer Utopie – in den Roman von 2017 hineingelesen. Auf diese Weise kann man zwar nicht Europa wohl aber die Rezensionskultur kaputtschreiben.