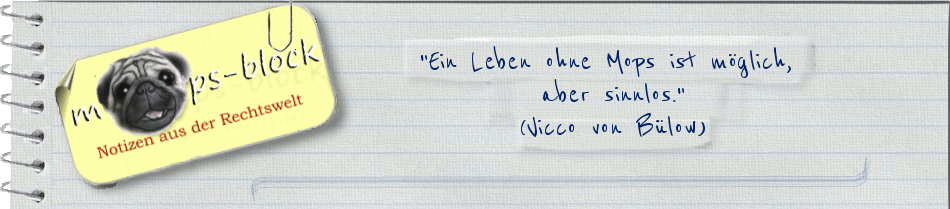Die deutsche Justiz ist immer wieder für Überraschungen gut. Das liegt nur zum kleinsten Teil an ihr selbst. Hauptverantwortliche sind die Natur und das Leben, die unermüdlich Unvorhersehbares, Erstaunliches, Sonderbares hervorbringen und die Justiz in der einen oder anderen Weise damit konfrontieren. Ihr letzter Streich, der vor der Justiz landete und deshalb überregionale Aufmerksamkeit erregte, betraf Herrn Michael und Frau F.
Michael und F. lernten sich zufällig kennen, richtiger: sie begegneten sich, denn recht eigentlich kennengelernt haben sie sich niemals - es sei denn, man sage in biblischer Manier, dass sie sich wechselseitig „erkannt“ und damit dann doch gekannt hätten. Kurzum: sie sahen sich, marschierten schnurstracks in ein Hotel und verweilten dort ohne Unterlass drei Tage und Nächte und schieden dann – vermutlich erschöpft – voneinander, ohne ein weiteres Wort. Ob sie überhaupt eines gewechselt haben, ist ungeklärt und strittig.
Das war im Juni vor genau 7 Jahren, vom 4.6 bis 7.6.2010 vermutlich in der bayerischen Metropole München, wofür einerseits das alsbald zu zitierende Münchener Amtsgericht und andererseits der in ländlichen Regionen nicht leicht vorstellbare Sachverhalt als solcher sprechen.
Martenstein, den diese Dauerlustnummer nicht weniger beschäftigt hat als viele andere, fragte kürzlich und verwundert im ZEIT-Magazin (18. Mai 2017), ob man „im Verlauf von vier Abenden“ nicht „doch auch mal telefonieren oder was essen“ (und dabei, so ist zu ergänzen, auch sprechen) muss.
Ob Martenstein mit dem vierten Abend angesichts der gerichtsnotorischen Termine 4.6. bis 7.6. und dem üblichen Hotel check-out um 12.00 Uhr nicht doch etwas übertrieben hat, lasse ich dahingestellt. Was das Telefonieren betrifft, möchte ich ein entsprechendes Bedürfnis glatt verneinen, einen Verzicht auf Essen allerdings für wenig plausibel halten.
Beim Essen muss man jedoch nicht reden, und vor Zeiten wurden Heranwachsende sogar dazu angehalten, Tischgespräche aus ästhetischen Gründen nicht essend, sondern nur in den Pausen zwischen den Gerichten, zu führen.
Wenn also, wie zu vermuten, Michael und F. sowohl auf den Tisch, als auch auf irgendwelche Pausen während des Essens verzichtet haben, ist leicht einzusehen, dass sie am Ende ihres Lustgeschäftes nicht mehr voneinander wussten, als dass sie eben Michael und F. gewesen sind und wie der jeweils andere so en gros und en detail beschaffen war.
Mit diesen Informationen ausgestattet und offenkundig in der festen Überzeugung, damit dürfe es sein Bewenden haben, schieden die Beiden voneinander.
Dass diese, je nach Veranlagung und Erfahrungsstand des Hörers, witzige, bemerkenswerte, unglaubwürdige, neiderregende oder missbilligungswürdige Geschichte überhaupt öffentlich wurde und dann zum Fall für die Justiz geriet, war ausschließlich dem Umstand zu verdanken, dass F., die üblichen neun Monate später, einen kleinen Joel (pace Martenstein, der immer etwas mehr weiß als wir anderen) gebar, der jetzt unterhalten und versorgt werden will. Was F. auf den naheliegenden Gedanken brachte, ihren Lustpartner am Resultat des seinerzeitigen Vergnügens zu beteiligen.
Das sollte, so glaubt man, im Zeitalter des gläsernen Zeitgenossen kein großes Problem sein. Die Fakten waren zwar spärlich, aber immerhin markant. Name des Hotels, Zeitpunkt der drei vollen Tage, Ort des Geschehens (die zweite Etage, wenngleich nicht die Zimmernummer), der Name des Standhaften (Michael) - das ist wesentlich mehr als einem Filmkommissar in aller Regel gegönnt wird.
Aber das um Auskunft gebetene Hotel bedauerte. Prinzipiell und speziell. Prinzipiell: die Diskretion und der Datenschutz - schließlich sei keiner umgebracht, sondern, im Gegenteil, einer gezeugt worden. Speziell: es kämen vier Michaele in Betracht, von denen schließlich nur einer zu Recht behelligt werden dürfe. Obendrein habe der Inhaber des Hotels gewechselt, und die alten Unterlagen seien verschwunden.
Die Kindsmutter zeigte sich uneinsichtig, klagte vor dem Münchner Amtsgericht und verlor.
Ich lese eine kleine Pressenotiz zu diesem Vorgang, und wundere mich über das Vier-Michaele-Argument. Es ist fadenscheinig. Dass auf derselben Etage, im selben Hotel, vier Michaele, vier Tage hintereinander gewohnt und womöglich auch noch in gleicher Weise unsichtbar ein gleiches Werk unbemerkt verrichtet haben könnten, sodass sie später nicht identifizierbar gewesen sein sollen, überzeugt mich nicht.
Das Interesse des Hotels an seinem Ruf als äußerst diskret und datenschützend? Sehr schön.
Aber wo bleibt das Interesse des neuen, wie doch immer ergriffen geredet wird, „Erdenbürgers“?
Und gibt es nicht vielleicht auch ein Interesse des vermeintlich fahnenflüchtigen Michael?
Auch wenn die Vorstellung vom genüsslich genießenden, alsdann aber schleunigst auf Nimmerwiedersehen entschwindenden Verführer empirisch satt belegt ist, handelt es sich doch bloß um ein Vorurteil. Vielleicht hat Michael sich im stillen und seit Jahrzehnten einen Nachkommen gewünscht, pfeift auf seine informelle Selbstbestimmung und wäre in Freudentränen ausgebrochen, wenn er von seinem Glück erfahren hätte?
Sind diese realen und idealen Interessen wirklich weniger wert als der Hotel-Charme der Verschwiegenheit?
So oder so ähnlich muss wohl auch die einst freudvolle, jetzt eher freudlose F. gedacht haben, bevor sie Klage auf Auskunftserteilung erhob.
Der Kindesunterhalt ist schließlich ein wertvolles Gut und zwar ein Gut ihres Kindes. Aber, wie es scheint, zieht die Justiz andere Güter vor, hält sie für wertvoller oder jedenfalls beim gegebenen Sachverhalt für schutzwürdiger. Wie dem auch sei, die Klage wurde abgewiesen. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Ich ereiferte mich. Was mögen das für Richter sein, frage ich mich? Vermutlich irgendwelche Tugendbolde. Die bekannte Mischung aus sittlicher Erhabenheit und Sexualneid. Ich phantasiere mich in die Gedankengänge dieser Puritaner und Sexisten:
„Geschieht ihr ganz recht, der Schlampe. Hinlegen und nicht nachdenken. Aber hinterher greinen und Ansprüche geltend machen. Nicht mal zum Aufpassen und Nachfragen hatte sie tagelang Lust vor lauter Lust.“
Ich fordere das Urteil an. Das ist heute einfach. Die Justiz legt inzwischen Wert auf Transparenz. Mit vollem Recht, und wirklich fortschrittsbewusst. Wem diese kaum begrenzbare Macht über das Leben seiner Mitmenschen eingeräumt wurde, der soll wenigstens nicht in der Lage sein, sein Gesicht und seinen Charakter hinter einem Vorhang von Normen zu verbergen. Er soll sagen, wer er ist und sich verantworten, für das, was er tut oder getan hat.
Das war dann allerdings doch ein bisschen zu viel des demokratischen Überschwangs und der Transparenzhoffnungen. Ein Vor-Urteil.
Der Name des Richters ist geschwärzt. Soll also doch nicht jeder so ohne weiteres wissen, wer da judiziert hat. Will man’s wissen, müsste man recherchieren. Das wäre gewiss möglich und wohl auch erfolgversprechend, ist aber umständlich, langwierig und langweilig. Belassen wir es bei meinem fehlerhaften Vorurteil über die Transparenzfreudigkeit der bayerischen Justiz.
Außerdem – zweite Enttäuschung – es war nur einer. Ein Einzelrichter. Einer ist zwar nicht keiner, aber eben doch nur einer. Einer kann umstandslos zur Ausnahme erklärt werden. „Richter NN ist eben streng“ –, und schon ist Schluss mit dem Generalverdacht auf geschlechtsspezifische Insuffizienz. Das macht die Entscheidung zwar nicht besser, schwächt aber erheblich mein schönes Vor-Urteil vom sabbernden Stammtisch zu kurz gekommener Männer.
Schließlich, letzte Enttäuschung, einfach unglaublich: es war überhaupt kein Mann, der da entschieden hat, sondern eine Frau. Eindeutig ist unter dem übertünchten Namen zu lesen „Richterin am Amtsgericht“.
Alle Hypothesen sind dahin. Eine Frau! Ein Weib! Das wird man kaum als Partisanin der männlichen Vorurteilswelt in Anspruch nehmen können.
Wütend kratze ich an dem weißen Lack, der den Namen dieser Richterin vor meinen Augen verbergen soll. Langsam enthüllen sich einige Buchstaben. „Reichle“ entziffere ich. Meine Übung im Lesen von Papyri und mittelalterlichen Handschriften ist hilfreich. Reichle? Vielleicht fehlt noch ein r? Reichler? Erinnert zu sehr an „Reich“ oder „reich“, was mir beides nicht gefällt, weil es mich in falsche Richtungen inspiriert.
Ich entscheide mich für „Reichle“ - ist schließlich nicht für mich, sondern nur für das Prinzip von Belang. Klingt außerdem warm schwäbisch, so wie Schäuble. Ich kann mir für den Anfang eine schwäbische Hausfrau vorstellen, einen Typus, mit dem bislang in den Richterbiografien kaum gearbeitet wurde, aber mit dem man vielleicht ein neues Modell kreieren kann.
Ich studiere das Urteil. Welche Gründe hat Richterin Reichle dort niedergeschrieben? Vielleicht komme ich damit hinter die anderen Gründe, jene, die sie bewogen haben?
Zuerst subsumiert sie sittsam unter § 28, Abs. 2, Nr. 2a BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) und bejaht das berechtigte Interesse der F., die jetzt „Klägerin“ heißt.
Dann paraphrasiert sie zwei entsprechende Abschnitte aus einem Kommentar zum BDSG, um die entsprechende Plattform zu gewinnen, auf der dann die „Abwägung“ zwischen den Interessen der Betroffenen stattfinden kann.
Was das Hotel betrifft, ist nicht allzu viel abzuwägen. Das Haus ist in andere Hände übergegangen, die alten Hände sind leer. Keine Software, keine Daten, nur noch ein paar Rechnungen. „Auf diesen seien“ – so zitiert die Richterin vom Hörensagen – „aber keine bestimmten Zimmer oder Stockwerke vermerkt, so dass die Abrechnungen einem bestimmten Gast aus dem zweiten Stock nicht eindeutig zuordenbar sind“.
Es geht also nicht eindeutig, sondern nur vierdeutig, was aber Frau Reichle dann doch viel zu weit geht. Schließlich ist aus dem Viererpack nur einer in den Genuss der Klägerin gelangt und die drei Unbeteiligten kämen notwendig unschuldig in Genussverdacht, wenn sie denn als potentielle Genießer ermittelt würden.
Was wäre daran schlimm? Nun, meint Frau Reichle, jeder hat das Recht, „geschlechtliche Beziehungen nicht offenbaren zu müssen“! Sehr gut! wäre ja auch noch schöner.
Und muss ich auch meine geschlechtlichen Nichtbeziehungen offenbaren?
Nein, sagt Frau Reichle, die geschlechtliche Nichtbeziehung darf ich nicht anders als die Beziehung ebenfalls geheim halten, denn durch die Preisgabe der Daten („Michael war vom 4. bis 7. Juni im Hotel“) wird bereits „die Möglichkeit einer geschlechtlichen Beziehung zu der Klägerin als Mutter des Kindes letztlich unwiderlegbar in den Raum gestellt“.
Völlig klar. Wer in der Nähe des Tatorts weilte, kommt als Täter in Betracht. Die Möglichkeit ist „letztlich“ unwiderlegbar, es sei denn der Katze konnte schon deshalb nicht auf den Schwanz getreten werden, weil sie keinen hatte oder die Michaele standen unter eheweiblicher Aufsicht. Dann wäre die Möglichkeit „letztlich“ doch widerlegbar.
Aber warum wäre der Verdacht der Täterschaft so gravierend? Moralisch mag man die Sache so oder anders sehen - rein physisch handelt es sich doch um eine durchaus stattliche Leistung! Nun, offensichtlich steht der Schutz der imaginierten Ehen und Familien der drei Nichtgenießer „im Raum“ - also die Zornesröte der Ehefrauen und der Mütter und Kinder des unschuldigen Trios.
Und wie – so spekuliert die Richterin Reichle weiter – wenn der „Michael“ gar nicht Michael hieß, sondern Thomas (Martenstein bringt einen „Jürgen“ ins Gespräch). Dann würde sich die Zahl der haltlos Verdächtigten auf vier erhöhen. Frau Reichle sieht die Gefahr der „Datenübermittlung ‚ins Blaue hinein‘ “ auf den Fall zukommen und beendet ihre Ausführungen zur Abwägung.
Sie hat die Interessen gewogen. Die des Jungen wurden nicht erwähnt und also wohl als zu leicht befunden.
Warum?
Dazu schreibt Frau Reichle nichts, und was sie sich gedacht hat, lässt sich ihren dürren und kalten Juristenworten nicht entnehmen.
Ob Frau Reichle auch selbst dürr und kalt ist? Ich möchte es gerne glauben, wage mich aber nicht mehr an meine vorurteilsbeladenen Vermutungen. Am Ende ist sie stattlich wie Franz Josef Strauß und ein Einser-Jurist wie Edmund Stoiber, obwohl dem ein so schlechtes Urteil vermutlich niemals entfahren wäre.
Ich verschiebe mein privates End-Urteil und mache mir einstweilen Gedanken, was wohl von einer rechtskundigen Person zu halten ist, die die Kraft hat, im Bereich der Logik der Vermutungen folgendes starke Argument zu entwickeln: Die Aussage „B ist nicht rot“ ist verträglich mit der Aussage „A ist nicht rot“? So nämlich explizit die Richterin Reichle bei ihren Feststellungen zu der (angeblich) verschwundenen Software:
„Auch spricht die Tatsache, dass dem Nachpächter des Hotels keine Unterlagen und Informationen vorliegen, nicht gegen die Annahme, dass die Beklagte ebenfalls nicht mehr über Informationen und Unterlagen aus dem Jahre 2010 verfügt“.
Was ist von einem solchen Denkkoloss zu halten? Ich fürchte: Nichts.
Dieter Simon