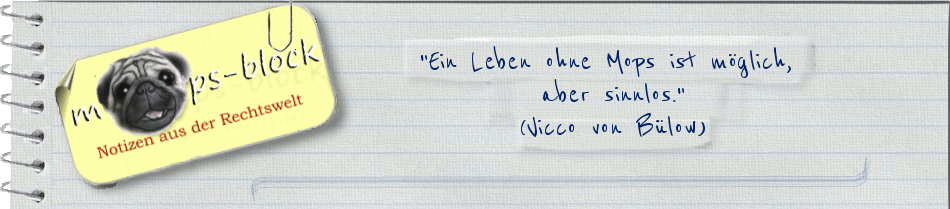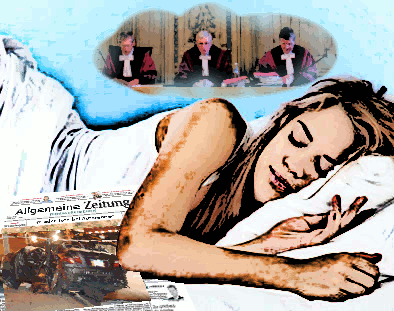
Heute Nacht habe ich von der Zukunft geträumt. Genau genommen, von der Zukunft der beiden Autofahrer, die soeben von der 35. Strafkammer des Berliner Landgerichts wegen Mordes mit gemeingefährlichen Mitteln verurteilt wurden: Zu lebenslanger Haft und lebenslangem Führerscheinentzug.
Ich bin kein Hellseher und habe mich auch nie für besonders prognosebegabt gehalten. Wenn ich trotzdem einmal versucht habe, eine über die Alltagserfahrung hinausreichende Vorhersage zu treffen – etwa anlässlich der Bundestagswahl 1969, wo ich der FDP wegen des besten Parteiprogramms aller Zeiten 15 % Minimum vorausgesagt hatte (es wurden 5,8) – bin ich fast immer auf die Nase gefallen. Also überlasse ich das Kaffeesatzlesen lieber anderen – es sei denn, die Zukunft erscheint mir im Traum. So wie in der letzten Nacht.
Nun war allerdings mein nächtlicher Blick in die Zukunft von Hamri H. und Marvin N., der beiden ich-starken Jungmänner, die sich vor gut einem Jahr in der Berliner Innenstadt unter Zuhilfenahme von 600 Pferdestärken ein illegales Autorennen mit tödlichen Folgen für einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer geliefert hatten, alles andere als detailversessen. Ich hatte nicht etwa eine Vision, wie die beiden künftig mit dem finalen Ergebnis ihres präpotenten Tuns umgehen würden, ob ihr Leben dadurch überschattet, ihre Lust am PS-verstärkten Kräftemessen für immer, nur vorübergehend oder überhaupt nicht gedämpft sein würde. Genau genommen tauchten die beiden in meinem Traum gar nicht selber auf. Es waren – gewiss als Produkt meiner professionellen Deformation – vielmehr die rot gewandeten Revisionsrichter, die im Jahr 2020 (diesbezüglich war ich mir beim Aufwachen übrigens nicht mehr ganz sicher) dem Berliner Landgericht sein Mordurteil mit trockener Juristenlogik um die Ohren schlugen. Ich weiß noch genau, dass ich im Traum so etwas wie Bedauern empfand, denn die Nachricht vom Berliner Richterspruch hatte bei mir durchaus so etwas wie grimmige Zufriedenheit ausgelöst.
Ich bin nicht habituell schadenfroh. Aber die Hilflosigkeit, die einen überkommt, wenn man von den Bewährungsstrafen erfährt, die etwa das Landgericht Köln in stabiler Rechtsprechung unlängst zwei notorischen Autowettrennern zugedacht hat, die den Tod einer 19-jährigen Radfahrerin zu verantworten hatten, verlangt nach emotionaler Kompensation. Die hat das Berliner Urteil geliefert. Weit mehr jedenfalls, als die Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten für den You Tube-Star „Alpi“, der auf seinem Motorrad mit gut 170 km/h durch die Innenstadt von Bremen zu rasen pflegte, und seine Heldentaten mit der Helmkamera filmte. Seine 80 000 Abonnenten liebten nicht nur die Videos, die beim Fahren auf Gehwegen, dem Überfahren roter Ampeln und dem Brettern über Straßenbahngeleise entstanden, sondern auch die dabei abfallenden Randbemerkungen, etwa die launige Kommentierung eines Beinahe-Zusammenstoßes mit einem Fußgänger: "Ist der behindert? Was war das? Behinderter Hurensohn! Er bleibt stehen, wie ein Reh! Er wäre gestorben. Ich hätte ihn in seine Einzelteile zerlegt, wie mein Lego. Voll der behinderte Wichser!"
Was „Alpi“ sagte, als er bei einer seiner Spritztouren einen 75-jährigen Verkehrsteilnehmer (kein Reh, sondern einen betrunkenen Fußgänger) ummöbelte, der kurz nach dem Zusammenprall an seinen Verletzungen starb, ist nicht überliefert. Später jedenfalls müssen ihm die passenden Worte eingefallen sein, denn sowohl das Gericht als auch ein hinzugezogener Gutachter bescheinigten dem reuigen Sünder, der für seine 200-PS-Kawasaki nicht einmal den erforderlichen Führerschein besaß, zwar noch etwas unreif, aber doch kein „Adrenalinmonster“ zu sein und weder suizidale noch fremdschädigende Motive gehabt zu haben. Schließlich habe er ja sogar abgebremst – der Aufprall fand bei knapp 70 km/h statt –, was vom Gericht offenbar für ausreichend befunden wurde, anders als die Staatsanwaltschaft ein Vorsatzdelikt zu verneinen und aufgrund des vierjährigen Führerscheinentzugs sogar künftige Gefahren durch den Raser „Alpi“ mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen.
Auf so viel Verständnis wären Hamri H. und Marvin N. wohl auch gern gestoßen. Die Berliner Strafkammer unter dem Vorsitz von Ralph Ehestädt mochte es aber nicht aufbringen. Dabei darf ihr wohl geglaubt werden, dass es weder die einschlägigen Vorbelastungen der beiden (19 bzw. 21 Verkehrsordnungswidrigkeiten. Gegen H. zudem der Vorwurf fahrlässiger Körperverletzung, Unfallflucht und eine laufende Bewährungsstrafe), noch ihre großmäulige Gossensprache waren, die den Gedanken an richterliche Milde gar nicht erst nicht aufkommen ließen. Den vom Angeklagten N. bereits früher ins Netz gestellten Schlachtruf „Wir ficken die Straße!“ hat Richter Ehestädt zwar in der mündlichen Urteilsbegründung nicht ohne Abneigung zitiert, ihn aber nicht zu einem tragenden Moment des Tatgeschehens hochstilisiert. Auch der naheliegende Gedanke, der wachsende Unmut der Öffentlichkeit über die als läppisch wahrgenommenen bisherigen Strafen könnte eine Rolle gespielt haben, wurde mit knappem Diktum weggewischt, denn: „Es geht nicht um Härte, es geht um geltendes Recht.“
Das sitzt! Das klingt nach einem: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Der Richter als bouche de la loi, von dem man eigentlich gemeint hätte, er sei längst ausgestorben. Im vorliegenden Fall ist diese Einlassung umso bemerkenswerter, als sich das Urteil auf einen Sachverhalt bezieht, der sich auf den ersten Blick in den relevanten Punkten in nichts von den anderen Raser-Fällen mit tödlichem Ausgang unterscheidet, die in letzter Zeit vor deutschen (auch Berliner) Gerichten auf Grundlage des nämlichen geltenden Rechts zur Aburteilung kamen. Sie waren meist (Ausnahme: Alpi) mit Geldbußen oder Bewährungsstrafen geahndet worden. Insofern darf man gespannt sein, weshalb die Berliner Richter des Jahres 2017 ihren Fall so anders einschätzten und zu einer Verurteilung wegen Mordes mit gemeingefährlichen Mitteln kamen.
Natürlich war diese Besonderheit auch der Berliner Spruchkammer klar, und nicht zufällig wurde die Urteilsbegründung mit dem Hinweis eingeleitet, dass es immer nur um eine Einzelfallentscheidung und nicht etwa um die rechtliche Verortung aller Raser-Fälle mit tödlichem Ausgang gehe. Persönlichkeit der Täter, Motivation und Tatumstände hätten gewürdigt werden müssen, und erst die Gesamtschau habe schlussendlich das konkrete Urteil ergeben.
Ja, was denn sonst, möchte man fragen. Das ist eigentlich Urteilsalltag. Das erklärt aber gerade nicht, inwiefern sich nach Würdigung aller Umstände das Berliner Raser-Geschehen vom Februar 2016 von der Vielzahl früherer Raser-Geschehen mit tödlichen Folgen so sehr unterschied, dass dieser Vorgang nach geltendem Recht als Mord gewürdigt werden musste. Vielmehr scheint dem unbefangenen Betrachter das hier beobachtete Zusammenspiel von wahnwitziger Selbstüberschätzung, Geschwindigkeitsrausch und Rücksichtslosigkeit geradezu idealtypisch für die gesamte Fallgruppe zu sein.
Ohne Zweifel hat auch die Berliner Strafkammer gewusst, dass sie sich auf dünnem Eis bewegte. Die PS-Monster unter das Mordmerkmal der gemeingefährlichen Mittel zu subsumieren, erfordert zwar etwas Begründungsaufwand, dürfte dabei aber nicht das Hauptproblem gewesen sein. Aber wie steht es um den Tötungsvorsatz? Kann man den tatsächlich aus dem Geschehen ableiten? Ehestädt fast entschuldigend: "Ihnen geht wahrscheinlich viel durch den Kopf: Sind diese Richter denn irre? Warum wir? Wir wollten doch den W. gar nicht töten! Wollen die Richter ein Exempel statuieren?" Den Versuch H.s auf diese Fragen einzugehen, blockt er dann allerdings mit einem „ich brauche keine Unterhaltung“ ab – so sind die Fronten wieder geklärt.
Aber der Richter möchte doch verstanden sein: Die Angeklagten hätten einen tödlichen Ausgang des Rennens natürlich nicht gewollt, „aber wir reden hier von einem bedingten Vorsatz“ erläutert er, als ob damit alles gesagt sei. Die Angeklagten seien mit bis zu 170 km/h durch die Innenstadt gerast, hätten also die tödlichen Folgen „billigend in Kauf genommen“. Sie hätten gewusst, was sie tun und trotzdem „weitergemacht“.
Das Gutachten der Schweizer Verkehrspsychologin Bächli-Biétry scheint in eine andere Richtung zu deuten. Sie spricht von einer Wahrnehmungsblase, in welcher Raser in ihrem Glauben an ihr fahrerisches Können gefangen seien. Eine Gefahr würden sie nicht realisieren. Ohne dass die Gutachterin die juristische Bewertung vornimmt, hat sie damit ausgeschlossen, dass der typische Raser (und damit auch der von ihr begutachtete H.) die Tötung eines Unfallopfers billigend in Kauf nimmt. Er sieht in seiner grenzenlosen Hybris gar kein Risiko, nimmt also auch nicht den Tod potentieller Unfallopfer „billigend“ in Kauf.
Nicht unplausibel – denkt man. Für diese Sichtweise spricht ja wohl, dass die Teilnehmer an illegalen Autorennen (nach dem Gesetz [§ 29 StrVerkO] handelt es sich dabei übrigens um übermäßige Straßenbenutzung, die, sofern folgenlos, mit maximal 400 Euro Bußgeld geahndet wird) weder ihr „ein und alles“ (H. über seinen getunten Audi) noch sich selber zu Schrott fahren möchten.
Doch das will dem Gericht nicht einleuchten. "Da ließen sich dann auch für viele andere Bevölkerungsgruppen Straflosigkeitsbereiche finden" trägt Ehestädt mündlich vor, und „auch der Raser bleibt ein Mensch, der einen Kopf hat.“ Er habe durchaus die „Möglichkeit von Einsicht und Erkenntnis“, könne also die Folgen einer höchstgefährlichen Fahrweise abschätzen. Den Angeklagten sei daher vollkommen klar gewesen, dass auf einer Hauptverkehrsstraße auch nachts ein Risiko bestehe, einen Menschen zu töten. Schon diese Gleichgültigkeit rechtfertige den bedingten Tötungsvorsatz, denn: „Raserei ist keine Krankheit“, und auch für „Protzer, die unbedingt Selbstbestätigung brauchen“, würde die Möglichkeit der Selbsterkenntnis bestehen.
Hier hat ein Gericht Dampf abgelassen. Man ist versucht, Applaus zu spenden und den Richtern zu bestätigen, dass sie es den PS-Machos zu Recht gezeigt haben, wo der Hammer hängt. Aber ist es der 35. Strafkammer damit tatsächlich gelungen, die tödlichen Folgen eines illegalen Straßenrennens überzeugend als Mord zu qualifizieren? Gerade die Ausführungen zu Einsicht und Erkenntnis zeigen, dass hier viel eher das psychische Konzept eines Richters als das eines Rasers entfaltet wurde. Und man kann es drehen und wenden wie man will: Tötungsvorsatz (und sei es nur der bedingte) ist durch die mündliche Urteilsbegründung auch nicht ansatzweise plausibel gemacht worden.
Da wäre ich wieder bei meinem Traum: Der BGH hat das Urteil auseinandergenommen, hat genüsslich die Abgrenzung von bewusster Fahrlässigkeit und bedingtem Vorsatz zelebriert und en passant darauf verwiesen, dass der Gesetzgeber das Problem ja inzwischen mit einer Verschärfung der Sanktionen bei tödlichen Raserunfällen geregelt hat.
Regina Ogorek