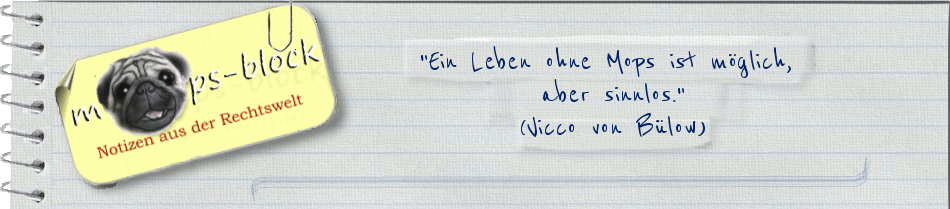Wer glaubt, dass die hohe Abgangsentschädigung, die Christine Hohmann-Dennhardt für ihr Ausscheiden aus dem VW-Vorstand erhalten wird, Ausdruck der Wertschätzung ist, die ihr für ihre 13-monatige Tätigkeit als Repräsentantin des Ressorts Integrität und Recht (neudeutsch: Compliance) vom VW-Aufsichtsrat entgegengebracht wird, irrt gründlich. Hohmann-Dennhardt hat vielmehr alles falsch gemacht. Sie ist die Verkörperung eines stark überteuert eingekauften beidseitigen Missverständnisses. Und das kam so:
Wer glaubt, dass die hohe Abgangsentschädigung, die Christine Hohmann-Dennhardt für ihr Ausscheiden aus dem VW-Vorstand erhalten wird, Ausdruck der Wertschätzung ist, die ihr für ihre 13-monatige Tätigkeit als Repräsentantin des Ressorts Integrität und Recht (neudeutsch: Compliance) vom VW-Aufsichtsrat entgegengebracht wird, irrt gründlich. Hohmann-Dennhardt hat vielmehr alles falsch gemacht. Sie ist die Verkörperung eines stark überteuert eingekauften beidseitigen Missverständnisses. Und das kam so:
Als laut einer Mitteilung vom Oktober 2015 der Daimler-Aufsichtsrat „im Interesse der Good Corporate Governance der deutschen Automobilindustrie“ (sic!) seine Vorstandsdame für Compliance offenbar mangels weiteren Eigenbedarfs an VW abtrat, schien das für alle Beteiligten ein gutes Geschäft zu sein. In den knapp 5 Jahren ihrer Tätigkeit hatte die mit gut 3 Millionen pro Jahr großzügig entlohnte Juristin mehrere Funktionen zur Zufriedenheit erfüllt: Zunächst einmal war sie ein Signal des guten Willens in Richtung der von der Politik mit wachsendem Nachdruck propagierten Frauenquote in den Vorstandsetagen gewesen. Hohmann-Dennhardt war gewissermaßen die Materialisierung des von deutschen Konzernleitungen gern gepflegten Arguments: Wir würden ja Frauen nehmen, wenn es doch nur geeignete Kandidatinnen gäbe. Meistens gab es keine; aber der promovierten Juristin, ehemaligen hessischen Spitzenpolitikerin und langjährigen Richterin am Bundesverfassungsgericht konnte man ohne Profilverlust zubilligen, dass sie auch auf höchster Ebene zu tauglichem Rechtsdienst imstande war. Konzernchef Zetsche konnte also weiterhin gegen die Frauenquote polemisieren und dennoch auf ein weibliches Paradepferd verweisen.
Das hätte aber sicher nicht gereicht, eine eigens auf den Typus Hohmann-Dennhardt zugeschnittene Vorstandsposition zu schaffen. 2010/2011 ging es für Daimler allenfalls ganz nebenbei darum, den vielen Selbstverpflichtungen in Richtung Frauenquote auch wirklich Taten, d.h. Frauen folgen zu lassen. Schlechthin unausweichlich war hingegen, nachhaltig gutes Benehmen im Sinne der Bereitschaft zur Good Governance zu demonstrieren. Das wiederum lag an einigen höchst prekären Auflagen, die man gerade in den USA eingefahren hatte. Dort war der Konzern wegen umfänglichen Korruptionsgeschehens ins Visier der US-Ermittler geraten und hatte im April 2010 vor der US-Justiz die Zahlung einer dreistelligen Millionensumme akzeptieren müssen, damit ein Verfahren wegen des jahrelangen korruptiven Vertriebs von Nutzfahrzeugen in 22 Ländern eingestellt werde. Zu den Auflagen gehörte die Zusage der Einrichtung eines Compliance-Ressorts, in welches zu allem Überfluss auch noch der frühere Mafia-Ermittler („Pizza-Connection“) und FBI-Direktor Louis Freeh als US-Monitor integriert werden musste. Vor diesem Hintergrund war die Inthronisierung eines Vorstands für Integrität und Recht im Jahr 2011 nicht unbedingt Ausdruck vorfindlicher und vorbildlicher Unternehmenskultur, aber verbunden mit der Besetzung durch eine Frau doch ein hübsches Versprechen künftigen Wohlverhaltens auf verschiedenen Ebenen. Nach Interviewaussagen der neuen Vorstandsfrau konnte man auf dem Gebiet der Compliance dann auch durchaus den einen oder anderen ansehnlichen Erfolg erzielen ("Neben Myanmar und Nordkorea sind wir auch nicht mehr in Iran tätig"), sodass der US-Aufseher bald von einem Goldstandard sprechen konnte, den Daimler hinsichtlich seiner Unternehmenskultur vorzuweisen hätte.
2015 war es dann nicht mehr Daimler, sondern der VW-Konzern, dem daran gelegen sein musste, mit Blick vor allem auf die USA Bestnoten in Richtung einer guten Governance zu erzielen. Dieselgate hatte sich aus der kleinen Schummelei nachgeordneter Ingenieure, als die es zunächst kommuniziert worden war, zu einem Skandal von apokalyptischen Ausmaßen entwickelt. Frühere Affären, etwa die Lustreisen von Betriebsräten auf Kosten des Unternehmens, wirkten dagegen wie Kinderkram. Der Abgasskandal ging ans Eingemachte. Was also lag näher, als es mit dem Tranquilizer zu versuchen, der – von den auszuhandelnden Strafzahlungen abgesehen – schon in der Schmiergeldaffäre von Daimler so kalmierend auf die US-Behörden gewirkt hatte: Mit einem Vorstandssessel für Compliance. Und um die Einarbeitungszeit in die unappetitlichen Teile der Branche abzukürzen, schien es sich geradezu aufzudrängen, die Spezialistin für Integrität und Recht gleich mit einzukaufen. Sicher nicht ohne eine gewisse Genugtuung („Nachdem Compliance fest im Unternehmen Daimler und seiner Kultur verankert sei…“) konnte der Autobauer daher im Oktober 2015 via Presseerklärung verkünden, dass man der Bitte des VW-Aufsichtsrats entsprochen und Frau Hohmann-Dennhardt aus ihrem bis Ende Februar 2017 laufenden Vertrag entlassen habe, damit sie ab Januar 2016 für Volkswagen in gleicher Funktion tätig werden könne.
So weit so gut? Ganz und gar nicht. Eher: So weit so schlecht! Denn hier beginnt das beidseitige Missverständnis, das nun zu dem teuren Abgang „im gegenseitigen Einvernehmen“ geführt hat.
Was die neue alte Vorstandsfrau anlangte, so hatte sie zu Beginn des Engagements aufgrund ihrer Daimler-Erfahrungen durchaus Grund anzunehmen, dass ein Konzern, dessen Reputation einen historischen Tiefpunkt erreicht hat, ein echtes Interesse daran hat, das Übel an der Wurzel zu packen. Das setzt, so durfte sie wohl glauben, bestmögliche Aufklärung und danach die Bereitschaft voraus, wo es sich als notwendig erweist, strukturelle Konsequenzen zu ziehen. Genau so muss Hohmann-Dennhardt ihre neue Aufgabe verstanden haben, denn – das verkündete sie kurz nach Amtsantritt in einem Interview – sie wolle den Gründen auf die Spur kommen, die zu dem gigantischen Desaster geführt hatten: „Wie kam es dazu, die Software zu installieren und das so lange laufen zu lassen? Warum ist das nicht früher ans Tageslicht gekommen? Welche Rolle spielte die Angst, bei einem Problem nicht weiterzukommen? Welchen Beitrag haben die Belohnungssysteme geleistet? Wie ist das Verhältnis von Führungskräften zu Mitarbeitern?“
Ja, das alles hätte der Rest der Welt auch gern gewusst. Aber der weitere Ablauf zwingt zu der Annahme, dass die Konzernspitze gar nicht daran interessiert war, dem Rest der Welt Antworten auf diese Fragen zu geben. Und wohl auch nicht daran, dass die neue Compliance-Frau sich diesen Fragen allzu engagiert widmete. Mit der professionellen Aufarbeitung der Affäre war nämlich zum Wohlgefallen der US-Behörden die weltweit tätige US-Kanzlei Jones Day beauftragt worden. Deren Ermittlungsbericht war der deutschen Öffentlichkeit zwar vollmundig angekündigt (VW-Chef Müller: „schonungslose Aufklärung“), seine Publikation aber mehrfach verschoben und zuletzt mit dem Hinweis, die Ergebnisse seien sämtlich in die Dokumentation der amerikanischen Justizbehörden eingeflossen und mehr gäbe es nicht dazu zu sagen, trocken zur Verschlusssache erklärt worden.
Chuzpe? Gewiss! Voraussehbar? Aber ja! Es wäre schon höchst sonderbar gewesen, wenn der Konzern zu einem Zeitpunkt, an dem überhaupt noch nicht absehbar war, wer alles sich durch die „Dieselthematik“ (VW-eigner Sprachgebrauch für die Abgasmanipulation) geschädigt fühlen mochte, die ersatzpflichtauslösenden Argumente als Tribut an eine neue Unternehmenskultur auf dem Silbertablett serviert hätte. Insofern war es auch konsequent, das Handling des Dieselkomplexes nicht etwa dem neuen Ressort Integrität und Recht zuzuschlagen, sondern damit zwei alte Konzernhasen zu betrauen: Den Einkaufsvorstand Francisco Sanz und den Chef der VW-Rechtsabteilung Manfred Döss. Döss war, bevor er zu VW ging, bereits Leiter Recht in der Porsche-Holding gewesen, und wohl nicht zufällig gleichzeitig mit Hohmann-Dennhardt bei VW eingerückt. Das hieß aber nicht, dass damit sein Engagement bei Porsche beendet war. In der Holding, die die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen-Konzern hält, blieb er der Chefjurist und wurde zudem – als Belohnung für glückliche Prozessführungen im Gefolge des seinerzeitigen Porsche-Überfalls auf VW – auf einen (neuen) Vorstandsposten für Recht und Compliance befördert. Dieser Mann sollte offenbar auch in der Abgasaffäre das Sagen haben, die ja – aufgrund undurchdringlicher Verquickungen der Eigentümerfamilien – irgendwo auch eine Porsche-Affäre zu werden drohte.
Und Christine Hohmann-Dennhardt? Bei VW war sie formal Vorgesetzte von Döss, aber mit den Entscheidungswegen im Konzern recht unvertraut. Deshalb hatte sie die ihr zugedachte Rolle der Kulturkosmetikerin entweder nicht als solche verstanden oder geglaubt, Fachkompetenz und erprobtes Durchsetzungsvermögen könnten eingespielte Machtverhältnisse ändern. Der Erfolg bei Daimler schien ihr diese Sichtweise zu erlauben. Aber da ging es um die Aufarbeitung von Vergangenheit und im Übrigen darum, einem breit gestreuten Aktionariat glaubwürdig zu vermitteln, dass die Konzernspitze begriffen hat, dass Reputation nicht nur einen moralischen, sondern vor allem auch einen ökonomischen Wert repräsentiert.
Bei VW lag und liegt die Sache völlig anders. Der Aufbau einer Compliance-Organisation sollte zwar das Signal an die Beobachter sein, dass man einiges tun wolle, um künftige illegale Machenschaften zu verhindern. Aber auf keinen Fall war beabsichtigt, die eigene Rechtsposition im aktuellen Aufarbeitungsprozess durch Offenlegung belastender Fakten zu schwächen. Insofern war das Bekenntnis zu neuen Integritätsstandards bestenfalls die Verheißung einer anständigeren Zukunft, aber sicher nicht die Ankündigung von Selbstbezichtigungen mit Blick auf die Vergangenheit. Politik, Gewerkschaften und private Hauptaktionäre konnten aus jeweils unterschiedlichen Gründen nur hoffen, dass bei den Untersuchungen der Affäre so wenig und nicht so viel Einzelheiten wie möglich öffentlich wurde.
Der aufklärungswilligen und vielleicht sogar -fähigen Hohmann-Dennhardt muss die Erkenntnis, dass nicht ihre Nachforschungen, sondern ihr Name, ihr Ruf und vielleicht noch ihre Rhetorik gefragt waren, ein böses Erwachen beschert haben. Spätestens als ihr Vorschlag, den versierten Ermittler Louis Freeh nach seinem erfolgreichen Monitoring bei Daimler auch im Rahmen des VW-Komplexes hinzuzuziehen, vom Aufsichtsrat noch im ersten Monat ihrer Tätigkeit kühl abgeschmettert worden war (wortführend hierbei übrigens Arbeitnehmervertreter Osterloh), musste wohl auch ihr dämmern, dass es im Rahmen der Dieselthematik um Darstellung und nicht um Herstellung von Recht und Integrität ging. Die Aktionärs- und Interessenstruktur des Konzerns, bei der es seit je um Arbeitsplätze auf der einen Seite (Politik/Gewerkschaften) und Profitmaximierung auf der anderen Seite (Porsche/Piëch) ging, hatte ihre eigene „Unternehmenskultur“ hervorgebracht: alte Seilschaften, an denen externe Compliance-Konzepte zerschellen mussten.
Für die Aufklärerin gab es also im Rahmen von Dieselgate gar keine Verwendung. In die Vergleichsverhandlungen mit den USA wurde sie ernstlich überhaupt nicht einbezogen. Die wurden vielmehr von den Vertrauten der Eigentümerfamilien Sanz und Döss geführt und haben, wie man weiß, inzwischen mit der Schnäppchen-Buße von 4,3 Milliarden ein mittelglückliches Ende gefunden.
Das beidseitige Missverständnis, von dem eingangs die Rede war, lag also auf Seiten von Hohmann-Dennhardt in der Annahme, sie solle tatsächlich die Affäre aufklären. Auf Seiten der Konzernleitung wiederum hatte man sich wohl nicht vorstellen können, dass ein Konzernneuling – aller internen Widerstände zum Trotz – darauf bestand, genau das tun zu wollen, wofür man ihn gerufen hatte. Offenbar ist man davon ausgegangen, dass das üppige Honorar ausreichen würde, übergroßen Ehrgeiz wenn nicht im Keim zu ersticken, so doch im Champagner zu ertränken.
Beide Seiten hatten sich also geirrt, und es war daher konsequent, der Sache „im gegenseitigen Einvernehmen“ ein Ende zu bereiten. Dass die offizielle Erklärung, mit der VW vorige Woche an die Öffentlichkeit trat, noch einen Grund für die Trennung angab („aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über Verantwortlichkeiten und die künftigen operativen Arbeitsstrukturen in ihrem Ressort“) war freilich äußerst ungewöhnlich und zeigt, wie unangenehm berührt die Chefetage durch unziemliche Kompetenzansprüche gewesen sein musste.
Und die 12 Millionen? Auf die hat die verhinderte Aufklärerin sicher einen vertraglichen Anspruch, der zu einem guten Teil in der Ablöse von Daimler seinen Ursprung haben dürfte. Und Grund, die VW-Leute durch Verzicht zu schonen, weil das Honorar angesichts ihrer verhinderten Leistungen doch ein wenig üppig erscheint, hat sie sicher auch nicht. So seien ihr die Mios gegönnt. Es bleibt freilich zu hoffen, dass Hohmann-Dennhard – falls sich für sie eine weitere Möglichkeit finden sollte, in einem Großunternehmen auf Recht und Integrität Einfluss zu nehmen – neben vielem anderen auch einmal das Thema Managergehälter auf ihre Agenda setzt.
Regina Ogorek