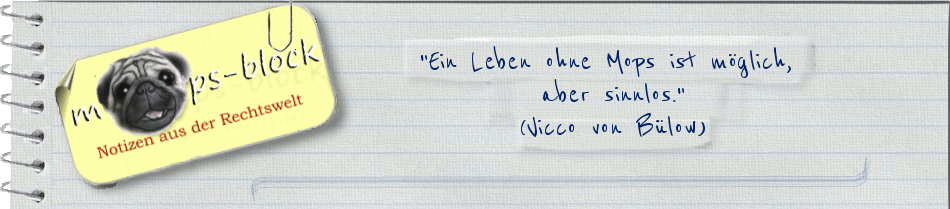Zugegangen:
Ulrike Babusiaux, Papinians Quaestionen, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte, 103. Heft, München 2011. Zugesendet, vielleicht von der Verfasserin, kann ich bei meiner dürftigen Ordnung und den vielen freundlichen Autoren, die mir ihre Produkte in der berechtigten Erwartung zusenden, daß ich mich darüber freue, nicht mehr feststellen. Jedenfalls bin ich gerührt.
I.
Die Münchener Beiträge existieren immer noch. Der Reihentitel löst bei meinen Studenten Verwunderung aus. "Papyrusforschung?" "Antike Rechtsgeschichte?"
Ich habe dort drei „Beiträge“ publiziert. Meine Dissertation, Heft 48, im Jahre 1964: Studien zur Praxis der Stipulationsklausel. Ein Titel so unbeholfen wie der Inhalt. Der römische „Verbalvertrag“, wie sich die Rechtshistoriker ausdrücken. „Versprichst Du?“ (spondesne?) sagt der eine, „Ich verspreche!“ (spondeo!) erwidert der andere, und schon ist der Vertrag verbal geschlossen. Folgen hat dieser mündliche Vorgang naturgemäß nur, wenn er beweisbar war. Also wenn er öffentlich stattfand - vor Zeugen, und nicht im Haus oder im Wald. Als die Römer zu schreiben begannen, haben sie vernünftigerweise ihren Verbalvertrag (die Stipulation, von stipulari = sich versprechen lassen) protokolliert. Jetzt konnte nicht nur bewiesen werden, daß ein Vertrag stattgefunden hatte, sondern auch, was sein Inhalt gewesen war. Das spondesne/spondeo wurde ebenfalls (am Ende des Textes) aufgeschrieben und bewies den Verbalvertrag, auch wenn die Partner kein Wort gewechselt haben sollten. Die Stipulation war zu einer Vertragsklausel geworden, die man sicherheitshalber einsetzte, so wie die Rechtsanwälte heute schreiben, daß sie, nachdem sie sich zu diesem oder jenem geäußert haben, „im Übrigen das gesamte Vorbringen des Gegners bestreiten“, um nicht von der Regel erwischt zu werden, daß der Schweigende zuzustimmen scheint. Die römische Klausel wanderte auch in die Verträge, die in anderer Sprache - etwa griechisch – nach römischem Recht geschlossen wurden, und als alle Bewohner des römischen Reiches nach Kaiser Caracallas Willen Römer geworden waren, schrieben auch die griechisch sprechenden Neurömer in Ägypten die Stipulationsklausel unter ihre Verträge. Sie hieß dort eperōtetheÌs homológesa (= gefragt, habe ich zugestimmt) und kommt massenweise in den Papyri seit dem 3. Jahrhundert nach Christus vor – auch dort, wo von „Vertrag“ schon deshalb nicht die Rede sein konnte, weil nur einer beteiligt war, wie bei einem Testament oder einer Quittung. Ein Rezeptionsvorgang mithin - den ich, so der Wunsch des Doktorvaters Johannes Herrmann, der auf Bitten von Wolfgang Kunkel als Experte die Betreuung übernahm, erläutern sollte. Ein wunderliches und absurdes Unterfangen, denn wie man aus der Existenz von zwei Worten ohne weitere Informationen die Motive und die Funktion dieser Worte erschließen soll, hätte mir eigentlich sogleich als eine nackte Unmöglichkeit einleuchten müssen. Es kam dann auch konsequent nichts weiter heraus als verzweifelte Sinngebung dem Sinnlosen. Und ein Riesengewinn: ich las 2 Jahre lang hunderte von Papyri durch und ergötzte mich am juristischen Alltag der hellenistischen Lebenswelt in Ägypten. Am Ende stand eine Arbeit, die (zu Recht) das Schicksal vieler deutscher Dissertationen teilte – außer dem Schreiber und seinem Betreuer liest sie (manchmal!) noch der Zweitkorrektor (Kunkel hat sie gelesen) und dann niemand mehr.
II.
Wobei es bei mir sogar noch eine Ausnahme gegeben haben muss. Jahrzehnte später hat mir einmal der österreichische Gräzist Prof. Dr. Dr.h.c. Gerhard Thür (zuletzt Graz) gesprächsweise und kollegial schonend mitgeteilt, daß ich bei meinen promotionsbedingten Deutungen dem Richtigen schon ziemlich nahe gewesen sei und das ersehnte Verständnis nur um Haaresbreite verfehlt hätte, wie er in einem zu erwartenden Sonderdruck darlegen werde. Der Sonderdruck kam auch, aber bevor ich ihm gerecht werden konnte, ging er wieder verloren, so daß ich unerleuchtet blieb und vermutlich bleiben werde.
Immerhin lag dieser Text völlig im Programm der langlebigen Münchener Beiträge, ein Programm, das der große Leopold Wenger (1874-1953) noch vor dem 1. Weltkrieg entworfen hatte. Er war der erste, der aus Historismus und dem legislativen Tod daß des römischen Rechts am 1.1.1900 zwei programmatische Folgerungen zog. Einmal, das römische Recht fernerhin nur noch als das Recht der Römer zwischen Aufstieg und Untergang des römischen Reiches (und nicht mehr als „heutiges römisches Recht“ der Pandektisten) zu studieren sei und zweitens, daß diese Studien, weil nicht nur die Römer die Antike bewohnt hätten, auf alle antiken Völker auszudehnen wären, wobei er fraglos zuerst an die hellenistischen Griechen dachte, über die man seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts durch Ausgrabung, Kauf und Raub der ägyptischen Papyri so ungeahnt viel in Erfahrung bringen konnte. Aber das Recht der Keilschrift und der Hieroglyphen sollte keineswegs prinzipiell ausgeschlossen werden. Antike Rechtsgeschichte als historische Rechtsvergleichung.
Das war das Programm eines Historikers und nicht das eines Juristen. Die juristischen Fakultäten, die allmählich anfingen sich zu fragen, wie lange sie sich das historische römische Recht noch bieten lassen müssten (sie müssen immer noch) waren nicht erbaut. Gegen die Legitimationsstrategie der Romanisten, die mit der scheinbar unwiderleglichen Maxime operierten, ohne römisches Recht sei das geltende (Zivil-)Recht nicht zu verstehen, war nichts auszurichten. Aber daß juristische Lehrstühle auch noch an Forscher vergeben werden sollten, die sich lebenslänglich mit Ur und Akkad oder der Oase Fayum beschäftigen würden, das ging zu weit. Außerdem war klar, daß nur das römische Recht jene Bildungskraft besaß, die man für die Rechtsjünger zu benötigen glaubte.
Wengers Programm fasste nur als Forschungsprogramm an einigen Universitäten Fuß. Als Bildungsprogramm für Juristen wartet es immer noch auf seine Chance, die aber vermutlich erst nach dem Abschied der letzten Romanisten, denen noch das heutige römische Recht im Kopf spukt, kommen wird. Das war der Hintergrund vor dem die Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte entstanden, verlegt bei C.H.Beck, herausgegeben von Leopold Wenger, der in seiner Münchener Professorenzeit das Seminar für Papyrologie gegründet hatte. Das erste Heft erschien 1915: Ernst von Druffel, Papyrologische Studien zum byzantinischen Urkundenwesen.
III.
1964, als „mein“ Heft Nr. 48 erschien, stand die juristische Papyrologie noch in voller Blüte, in München, Erlangen, Freiburg, Frankfurt, Heidelberg, Marburg saßen Rechtshistoriker, die mit den immer noch anschwellenden Editionen von Papyri nichtliterarischen Inhalts etwas anzufangen wussten. Damit ist es vorbei. Nach der Emeritierung von Hans Albert Rupprecht (Marburg) ist der letzte Jurist, von dem man mit Recht behaupten konnte, er sei Papyrologe, von einem juristischen Lehrstuhl verschwunden. Was man den Juristen nicht übel nehmen kann. Und der Forschungspolitik könnte man es verzeihen, wenn sie an anderer Stelle Ersatz geschaffen hätte.
Als dann 1969 meine Habilitationsschrift (Untersuchungen zum justinianischen Zivilprozeß) als Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte Heft 54 erschien, hatte sich die akademische Welt bereits erheblich verändert. Die Generation der letzten Kriegsteilnehmer trat ab und mit ihnen jene Forscher und Lehrer, die nach 1945 an ihre Studienzeit vor dem ersten Weltkrieg angeknüpft hatten. Das humanistische Gymnasium war auf dem Rückzug. Griechisch nur noch einem kleinen Bruchteil der Studierenden vertraut. Latein noch verbreitet, aber das große Latinum für ein Jurastudium nicht mehr Voraussetzung. Römische Rechtsgeschichte und römisches Privatrecht nicht mehr getrennt je 4-stündig, sondern zusammengelegt 3-4 stündig. Digestenexegese als Zulassungsvoraussetzung für eine Promotion entfallen. Die natürliche Ehe zwischen Privatrecht und römischem Recht? - geschieden. Immer mehr Vertreter des Privatrechts ohne Vorstellung davon was die Pandekten sind, immer mehr Professoren der Privatrechtsgeschichte der Neuzeit ohne Schulung in den Pandekten. Rückzug des „überwölbten“ Privatrechts zugunsten des öffentlichen Rechts. Neue Fakultäten in neuen Universitäten. Nur selten mit einem Lehrstuhl für Römisches Recht bestückt. Antikes Recht als Bezeichnung eines Lehrstuhls? Nirgends.
Mein Beitrag (Justinian!) lag bereits an der Grenze von Wengers Programm “Antike Rechtsgeschichte“. Für die Rechtsbyzantinisten (ihre Epoche: von Konstantin dem Großen bis zum Fall von Konstantinopel) beginnt mit Justinian schon das Mittelalter. 1973 als „Zyprische Prozeßprogramme“ erschien (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, Heft 65) war der Rahmen den Wenger gezogen hatte, völlig gesprengt. Eine zypriotische, dialektal gefärbte Übersetzung von Verfahrensklischees aus dem römisch-kanonischen Prozeß, den die Lateiner in Zypern implantiert hatten. Kulturhistorisch, sprachlich, rechtshistorisch eine originelle Rarität. Vielleicht deswegen am wenigsten beachtet, obwohl dieser Fund die meiste Beachtung verdient hätte.
IV.
In den Münchener Beiträgen sind seitdem knapp 40 weitere Titel erschienen. Die Geschichte überwiegt. Römische und hellenistische Historie. Papyrologie ist verschwunden. Das klassische römische Privatrecht aber auch. Gelegentlich noch ein Titel mit „Weinkauf“ oder „Marktkauf“ oder actio in rem verso u. ä. Ansonsten Rechtsgeschichte, kein Privatrecht, das als dogmatisches Aphrodisiakum gelehrt werden könnte. Sozialhistorische Fragestellungen. Auch schon ein Text von Ulrike Babusiaux. Id quod actum est. Zum vorprozessualen Verhandeln über den Streitstoff. Verfahrensrecht also, im weiteren Sinne. Eine lesenswerte Arbeit für alle, die nicht an der Dogmatik, sondern an der römischen Rechtsrealität interessiert sind.
Das Forschungsparadigma „römisches Privatrecht“ sei erschöpft, hat Helmut Coing (1912 - 2000) schon zu Beginn der 70er Jahre gutachtlich der Deutschen Forschungsgemeinschaft signalisiert. Jetzt macht sich die Lage nicht nur in den Monographien, sondern langsam auch an den Lehrstühlen bemerkbar. Allmählich. Obwohl die alte Legitimation vom römischen Recht als Verstehensbedingung für das geltende Recht als unplausibel kaum noch geäußert wird. Man schweigt und beruft immer dünner werdende Romanisten. Lehrstühle haben eben einen langen Atem. Auch wenn niemand mehr sagen kann, wem und wozu ein bestimmtes Wissen dienlich sein möchte, ficht dies die Wissenden nicht an. Kameralistik wurde noch viele Jahrzehnte nach dem Untergang der letzten fürstlichen camera gelehrt. Aber das Ende kommt dann doch.Nicht Abschaffung, sondern Erlöschen. Ist auch gnädiger.
Und was wird aus der romanistischen Forschung? Rechtsgeschichte der Römer perdu? Soll ich meine Ausgaben der Digesten wegwerfen? Das wäre schade. Denn es steht noch viel Aufregendes und irgendwie Nichtgelesenes darin.
V.
Das zeigt dem Zweifler Ulrike Babusiaux, Lehrstuhlinhaberin in Zürich. Vielleicht der Lehrstuhl von Marie Theres Fögen. Die würde sich jedenfalls gefreut haben, hätte sie eine Nachfolgerin gefunden, die nicht weniger ingeniös und unerschrocken ist, als sie es war. Nach Id quod actum est (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, Heft 95, 2006!!), wo der Scharfsinn und die kenntnisreiche Präzision der Autorin bereits allerhand romanistische Vorurteile davonjagte, jetzt Heft 103 (2011). Daß sie sich gleich an Papinian gewagt und ein großes Buch geschrieben hat, war trotz des Vorlaufs noch eine schöne Überraschung. Ausgerechnet Papinian, der Dunkle und auch deswegen Verehrte, der Problematische und Edle und sein unbestritten weitaus schwierigstes Buch: die Quaestiones. Davon wird zu reden sein.
<hrdata-mce-alt="Babusiaux 2" class="system-pagebreak" />
Das Buch von Ulrike Babusiaux zielt auf die bislang nicht hinreichend sachkundig erörterte Frage nach dem Verhältnis der römischen Juristen zur Rhetorik. Nicht sachkundig deswegen, weil die romanistischen Rechtshistoriker zwar in der Regel mit Akribie und Ausdauer ihre Pandekten studierten, denselben Fleiß gegenüber den Rhetorikern – vor allem Cicero und Quintilian – aber vermissen ließen. Verantwortlich ist dafür weniger Ignoranz oder Faulheit als ein explizites Forschungsinteresse, das sich konzentriert auf die justinianische Sammlung der so genannten klassischen Texte der römischen Jurisprudenz richtete.
Mit dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches am 1. Januar 1900, wurden die Digesta Iustiniani vom Anwendungsdruck des „heutigen römischen Rechts“ befreit und mutierten zur historischen Quelle. Die Pandektisten wurden nicht mehr zu Rechtshistorikern, aber erste historische Blicke richteten sie schon noch auf die Digesten. Und ihre Schüler nahmen die Aufgabe in die Hand, das Rechtswissen der großen römischen Juristen zu untersuchen und abzubilden.
Wobei zwei Gesichtspunkte im Vordergrund standen. Einmal wußte man, denn man sieht es und Justinian sagt es, daß man die Schriften dieser Juristen nur als Fragmente und Schnipsel vor Augen hatte und daß diese Fragmente in vielerlei Hinsicht von der justinianischen Gesetzgebungskommission bearbeitet worden waren. Was alles verändert worden war, und wie genau verändert, wusste man freilich nicht, und weiß man bis heute nicht. Kürzungen? Sicher! Aber welche? Veraltetes!? Aber was heißt veraltet? Die sprachliche Fassung, der normative Gehalt? Eigentlich war alles veraltet, denn von Ausnahmen abgesehen, waren die Fragmente aus den ersten 2 Jahrhunderten p.C. in Justinians Zeitalter schon zwischen 300 – 500 Jahre alt.
Vieles galt jedoch noch oder sollte gelten oder sollte erneut gelten. Also das Geltensollende wurde ausgeschnitten aus den „Klassikern“ – die sich freilich vielfach widersprachen, weshalb Justinian die Harmonisierung anordnete. Und die Ordnung der Fragmente in Sachgruppen und die Verbindung der Fragmente innerhalb der Titel, damit man eine Ordnung hatte, mit der man arbeiten konnte. Das war der Gesichtspunkt „Textveränderung“ durch die „Byzantiner“, wie die Juristen des 6. Jahrhunderts von denen genannt wurden, die sich an die Aufdeckung der Interpolationen Justinians machten. Der zweite Gesichtspunkt war eine Vision. Eine Vision von der Sprache der Klassiker, die man in der justinianischen Sammlung zu erkennen glaubte, wobei man vergaß, daß Justinian durch seine Exzerptarbeit nicht nur die Werkformate zerstört, sondern auch durch seinen legitim auf die aus den Gutachten und Voten zu extrahierende Rechtsregel fixierten Blick diese Sprache gewissermaßen erst hergestellt hatte, so daß sich – versetzte man die Kompilation einfach um 300 Jahre zurück – eine in dieser Zeit ziemlich isoliert dastehende Fachsprache erkennen ließ, die man der erst in Ansätzen individualisierten Klasse der „Klassiker“ als gemeinsame Rechtssprache unterstellte. So daß Lücke und Widerspruch, die schon den Humanisten geläufigen Indikatoren für das Eingreifen Justinians, aufs Nachdrücklichste durch die Sprache, die man noch um eigene Stilideale (nüchtern, einfach, würdevoll – wie die alten Römer eben) bereicherte, ergänzt wurden. Als man sich schließlich klar gemacht hatte, daß auch zwischen 200 und 500 p.C. die klassischen Texte nicht nur abgeschrieben, sondern auch „nachklassisch“ bearbeitet worden waren, wie man beim Vergleich von außerhalb der Digesten überlieferten Bruchstücken aus dem 3. und 4. Jhdt. mit der Pandektenüberlieferung erkannte, trat der „nachklassische Bearbeiter“ neben den „Byzantiner“.
VI.
Zusammen gestatteten sie dem arglosen Forscher die Säuberung der Digesten von allem, was ihm (meist sachlich) nicht passte und erlaubten, ein römisches Privatrecht zu entwickeln, das Plausibilität und Geschlossenheit der nahezu flächendeckenden „Korrektur“ und „Konjektur“ der Überlieferung verdankte. Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts dämmerte den Gelehrten die Einsicht, daß sie sich verrannt hatten. Vorsichtige Rückwärtsbewegungen begannen: man sah ein, daß die Klassiker kein monolithischer Block gewesen sein konnten, sondern Rechtsdenker mit subjektiven Überzeugungen, die kontrovers dachten, gegeneinander agierten, Fehler machten, unterschiedlich begabt waren. Man sah, daß der „nachklassische Bearbeiter“ vielleicht Auszüge machte, annotierte, vereinfachte, aber weit entfernt war von „Überarbeitung“ und daß vollends die konservativen und ehrfurchtsvollen „Byzantiner“ als Umschreiber überhaupt nicht in Betracht kamen.
Insgesamt lief die Bewegung einfach zurück – neue Interpretationsmethoden jenseits der mehr oder minder plausiblen Dogmenrekonstruktion wurden nicht entwickelt.
Das hat erst Ulrike Babusiaux begonnen. Sie hat sich kühn und richtig genau den Mann ausgesucht, dem die Interpolationenkritik am heftigsten und bis zur Schwelle der Lächerlichkeit zugesetzt hat, nämlich den großen und originellen Papinian, dessen eindrucksvollstes Werk, die „Fragen“ (Quaestiones), gerade wegen der Sprache – es riecht auf Schritt und Tritt nach Rhetorik – der kritischen Verdammung anheimgefallen war. Rhetorik – das war klar, paßte nicht zu einem Klassiker, mochte es auch ein Spätklassiker sein (Caracalla ließ Papinian 212 p.C. töten). Denn Rhetorik, die für die Textkritik immer noch im Wesentlichen Stilistik und nicht Argumentationslehre war, war Pathos statt Sache, Schmuck statt Argument, geschwollen statt schlicht - also unrömisch und damit nachklassisch.
Weshalb Fritz Schulz das ganze Werk einem Nachklassiker zuschob und noch der überaus kluge und tiefschürfende Franz Wieacker – gewiß auch ein wenig aus Respekt vor dem vertriebenen und tabuisierten Schulz – erfand in seiner wissenschaftlichen Verzweiflung zwischen Einsicht und Vorurteil einen gewitzten Nachklassiker, der Texte von papinianischem Gehalt in nicht papinianischer Manier geschrieben habe. Eine Groteske, von der sich Wolfgang Kunkel im Seminar, ohne ein kritisches Wort, einfach mit listigem Lächeln und der Schilderung der Leistungen dieses Papinianisten verabschiedete.
<hrdata-mce-alt="Babusiaux 3" class="system-pagebreak" />
VII.
Ulrike Babusiaux geht für ihre Frage nach der Rhetorik bei Papinian andere Wege als ihre Vorgänger.
Zunächst versteht sie Rhetorik als eine elaborierte Argumentationslehre im Dienste der Persuasion. Persuasio im römischen Sinne als Überzeugung und Überredung, entsprechend der Einsicht, daß „Überredung“ nichts anderes ist als das Resultat einer Reflexion auf die Überzeugung von gestern.
Damit ist die vom Großteil der Romanisten ohne Bedenken übernommene Haltung der Aufklärung, die Rhetorik auf den Redeschmuck, den Ornat der elocutio, zu reduzieren, erst einmal zurückgewiesen. Es ist nicht von Wortgeklingel und Stilistik die Rede, sondern vom theoretischen Status, der Funktion und dem Einsatz von Argumenten, unabhängig von ihrem sachlichen Gehalt.
Dazu bedarf es naturgemäß eines genauen Studiums der rhetorischen Lehren, am besten nicht nur bei dem unverzichtbaren Lausberg, der gewiß auf der Autorin Schreibtisch stand, sondern auch bei Cicero und dem im 19. Jhdt. endgültig dem Vergessen überantworteten Quintilian, da andernfalls der textkritische Exeget nicht eigentlich wissen kann, wovon er redet, wenn er nach Romanistenmanier von rhetorischer Kleidung, Farbe, Verzierung etc. plappert. Vor allem der pädagogisch unübertroffene Quintilian (35 - 96 p. C.), der Prinzenerzieher, Professor der Redekunst, Schriftsteller und penible Chronist römischer Rezeption griechischer Redekunst, ein Mann mit ausgedehnter forensischer Praxis, Zeitgenosse großer Juristen, wenn auch nicht der gerade des Spätklassikers Papinian verdient die größte Aufmerksamkeit und hat sie bei Babusiaux gefunden. Bei ihm, der das zeitgenössische römische Recht genau kannte – schreibt er doch mehr als einmal für seine Schüler juristische Voten als „für den Anfänger zu schwer“ in einfachere rhetorische exempla um, damit Einsatz und Wirkung eines Arguments klar werde –, durfte die Autorin hoffen, über die argumentative Ausstattung, über die alle gebildeten Römer (also auch die Juristen) seines und des nächsten Jahrhunderts verfügten, genau instruiert zu werden. Und so sehen wir sie denn im unaufgeregten und souveränen Besitz aller rhetorischen Wort- und Satzfiguren und strategischen Persuasionsrezepte an die Quaestionen Papinians herantreten.
Natürlich bedurfte es dann noch sehr fundierter Kenntnisse im römischen Recht und eines nicht unerheblichen Scharfsinnes – Eigenschaften, die man ihren Vorgängern allerdings kaum wird absprechen wollen, und schon wird alles leicht und fügt sich zueinander.
VIII.
Babusiaux gliedert das Material in drei Teile – Kommentare zum Kaiserrecht, Auseinandersetzungen mit den Meinungen älterer und jüngerer Juristen und beziehungslose, besser: nur auf schwierige Problemkonstellationen bezogene Erörterungen. Dabei kommen ihr die (von ihr so genannten) Katenen zugute – längere Zusammenstellungen von Fällen, Fragen, Variationen, die die bisherige Forschung gern als „assoziative“ Reihung bezeichnet, und von denen die Verfasserin vermutet, daß sie nicht nur aus Reverenz gegenüber dem großen Papinian von den Kompilatoren in ihre Sammlung aufgenommen wurden, sondern weil sie in ihnen eine argumentative Einheit gesehen hätten. Eine Hypothese, mit der die Verfasserin aus zweierlei Gründen gewiß das Richtige trifft. Einmal beweist sie selbst, daß dieser Zusammenhang besteht und zum anderen waren die Kompilatoren wesentlich besser über ihre Fragmente im Bilde als es vielen ihrer Kritiker scheinen mag. Schließlich hatten sie bei Rechtslehrern von der Qualität eines Thalelaios studiert, dem die griechische Rhetorik sicher kein Buch mit sieben Siegeln war.
Zunächst wird der Leser demgemäß an der sicheren Hand der Autorin durch eine stattliche Summe exzellenter Exegesen geleitet. Mit äußerster Akribie, bewundernswerter Raffinesse und ohne jede gewaltsame Hermeneutik zeigt die Verfasserin die Konsequenz, ja die Notwendigkeit der Argumentenfolge in den einzelnen Katenen auf, wobei ihr die rhetorische Schulung genau den Weg weist, mit dem sie die persuasiven Pläne des Redners sowohl enthüllen, als auch verständlich machen kann. Mit Sätzen wie S.73: „Ausweichen auf den Sachverhalt bietet sich an, wenn eine controversia vorliegt oder wenn das theoretisch schwache Argument kasuistischer Stütze bedarf (Quint.7.6.6)“ oder S.107: „Aus Sicht der rhetorischen status-Lehre bedarf der vom Wortlaut abweichende Wille besonderer Rechtfertigung durch aequitas und exempla (Quint. 7.6.7.)“ machen ganze Kavalkaden textkritischer Einwendungen und juristischen Rätselratens obsolet. Ein Genuss selbst für distanzierte Liebhaber des römischen Rechts und, wenn es denn sinnvoll wäre, exzellentes Material um ihm Jünger und Bewunderer zuzuführen.
Die Frage und Antwort-Struktur des Werkes, ein uralter rhetorischer Werktypus, der sich bis in die spätbyzantinischen Erotapokriseis fortschreibt, den schon deswegen als Unterrichtsbuch zu bezeichnen reichlich naiv wäre, wird anhand der eingesetzten Argumentationsmuster auf der Mikroebene untersucht, so daß am Ende das gesamte Quaestionenwerk nicht mit neuen, aus der Luft gegriffenen Werkskategorien erfaßt, sondern umstandslos als klassische Diatribe beschrieben werden kann. Welche Motive endlich Papinian bewogen haben mögen, seine juristische Kunst mittels der philosophisch-rhetorischen ars dicendi zu präsentieren, mag dahinstehen.
Viel wichtiger scheint mir ein Hinweis auf den Gewinn, den die juristische Rhetorik aus diesem Buch ziehen kann, auch wenn es, wie die Autorin betont, nicht für sie geschrieben ist. Die Argumentationslehren von Aristoteles bis Quintilian leiden an einem evidenten Mangel an juristisch-dogmatischen Beispielen, was wenig erstaunt bei einer formalen ars bene dicendi, die auch für Politik, Moral, Kunst, kurzum: für das ganze Leben und nicht nur für die Juristen – die das allerdings kaum begreifen mögen – zuständig sein will. Was ihr prompt den Verdacht der Rechtshistoriker, die in den rhetorischen Deklamationen nicht fündig werden konnten, eingebracht hat, das mangelnde pädagogische Interesse an präziser Rechtslehre und verwickelten Fällen müsse als Beleg für mangelnde Fähigkeiten gedeutet werden. Mit dem Buch von Babusiaux kann man jetzt studieren wie einst ein meisterlicher Einsatz der Argumentationskunst in der Rechtskunst ausgesehen hat – und wie er immer noch aussehen könnte.
mops-block
Babusiaux
- Details