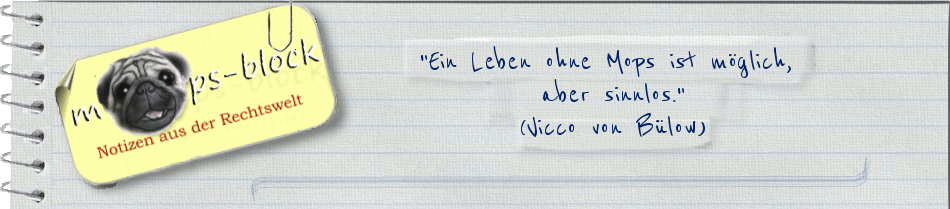Am 14. März wurde Geschichte geschrieben. Wieder einmal. Diesmal von Juristen, die ja normalerweise nicht im Verdacht stehen, historische Ereignisse zu produzieren. Als aber am Mittwoch der argentinische Chefankläger des ständigen Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in Den Haag Luis Moreno Ocampo vor die Kameras trat, um mit bewegter Stimme den soeben vom Gericht verkündeten Schuldspruch als Meilenstein in der internationalen Völkerrechtsgeschichte zu kommentieren, ging es tatsächlich um Einzigartiges:
Nach 204 Prozesstagen und der Vernehmung dutzender Zeugen waren die drei Richter der zuständigen Strafkammer zu dem einstimmigen Votum gekommen: "Thomas Lubanga Dyilo ist als Mittäter verantwortlich für das Anwerben und die Rekrutierung von Kindern unter 15 Jahren für die Patriotische Befreiungsarmee FPLC."
Nun ist vielleicht nicht jeder von dem Ereignis so beeindruckt wie der Vertreter der Anklage. Die solitäre Eigenart des Schuldspruchs – das Strafmass wird später festgesetzt – mögen manche vor allem darin sehen, dass es sich um die erste (sic!) Schlussentscheidung überhaupt handelt, zu der sich das vor 10 Jahren installierte ,Weltgericht’ (,Welt’ freilich ohne Amerika, Russland und China !) durchzuringen vermocht hat. Ob man dies bereits zum Anlass nehmen will, die Institution und ihr Personal zu preisen, kann dahinstehen. Festzuhalten bleibt, dass das Lubanga-Verfahren den bisherigen Output um eine nicht zu beziffernde Prozentzahl gesteigert hat. Die Medien haben dies als Durchbruch gerühmt. Und die Erleichterung von Moreno Ocampo lag wohl nicht zuletzt darin begründet, dass es während der 6-jährigen Verfahrensdauer – Lubanga war 2005 festgenommen und 2006 dem ICC überstellt worden – etliche Klippen zu überwinden gab, die eine Einstellung des Verfahrens und die Freilassung des Angeklagten aus prozessualen Gründen in bedrohliche Nähe gerückt hatten. Alles in allem schon Grund genug, den letztendlichen Sieg zu feiern, aber nicht allzu triumphal zu zelebrieren.
Bei genauerem Hinhören lassen sich aber im allgemeinen Jubel noch weitere irritierte Töne ausmachen. Der kongolesische Milizenführer Lubanga ist von Zeugen als grausamer Sadist beschrieben worden. Unter seinem Befehl hat die FPLC mit äußerster Brutalität im Ostkongo ganze Regionen terrorisiert, und von ihm selbst wird berichtet, dass er gelegentlich mit knappen Handbewegungen Massenhinrichtungen anordnete. Seine Miliz machte Dörfer dem Erdboden gleich, erschlug die Bewohner und hackte sie mit Buschmessern in Stücke, folterte und verstümmelte vermeintliche Abweichler und organisierte Massenvergewaltigungen. Vor diesem Hintergrund klingt die richterliche Feststellung, Lubanga sei der Mittäterschaft beim Anwerben und Rekrutieren von Kindersoldaten überführt, was als Kriegsverbrechen zu werten und deshalb zu verurteilen sei, in vielen Ohren wie eine Verniedlichung des Gesamtgräuels. Die letztliche Beschränkung der Anklage auf diesen Punkt hatte der Anklagevertretung deshalb bereits in der Vergangenheit heftige Kritik von Menschenrechtsorganisationen eingetragen, und auch am Verkündungstag wurde in manch feierlichen Kommentar dieser Wermutstropfen eingemischt. Anneke van Woudenberg etwa, die Prozessbeobachterin von Human Rights Watch (HRW), konstatiert zwar, wie viele andere, das Historische an dem Richterspruch, ergänzt aber gegenüber der ARD doch frustriert: "Lubanga und seine Bewegung waren für viel mehr Verbrechen verantwortlich. Angeklagt wurde er aber nur wegen des Einsatzes von Kindersoldaten. Den Menschen im Osten des Kongo, die unter ihm gelitten haben, die gefoltert wurden und deren Töchter oder Mütter vergewaltigt worden sind, ist heute keine Gerechtigkeit widerfahren.“
Trotz der historischen Dimension keine Gerechtigkeit für die Opfer? Was lief denn schief? Die nüchterne Antwort lautet: Grosso modo gar nichts. Doch offensichtlich wurden mit dem limitierten Schuldspruch Erwartungen verfehlt, die von vielen Beobachtern und gewiss auch von Opfern oder Hinterbliebenen an den ICC herangetragen werden. Und hier liegt tatsächlich ein Problem. Denn der ICC wird an Ansprüchen gemessen, die für ihn nicht passen, niemals gepasst haben und auch niemals passen sollten. Paradigma für das, was vom Haager Gerichtshof gern erwartet wird, ist die rechtsstaatliche nationale Strafgerichtsbarkeit. Von dieser wird zu Recht erhofft, dass sie im Rahmen des Legalitätsprinzips die Täter verfolgt und ihre Verbrechen tat- und schuldangemessen ahndet. Dass sie zumindest versucht, alle relevanten Vorkommnisse aufzuklären und einer strafrechtlichen Beurteilung zuzuführen. Nur das – so die Unterstellung – verschafft den Opfern Genugtuung, erfüllt das unausgesprochene, aber vorhandene archaische Bedürfnis, mit der Strafe das Verbrechen zu kompensieren, gleichermaßen durch eine Art Gegenzauber aus der Welt zu schaffen. Und auch wenn jeder weiß, dass dieser Anspruch der Wirklichkeit noch nie ganz Stand gehalten hat (Paradebeispiel hierfür ist der Vielfachmörder Al Capone, der nicht für Mord, Raub oder Erpressung, wohl aber für Steuerhinterziehung und unerlaubten Waffenbesitz verurteilt und nach Alcatraz geschickt wurde), wurde der Maßstab der allgemeinen Strafgerichtsbarkeit auf den internationalen Gerichtshof übertragen und seit seiner Gründung die Hoffnung auf eine Art Weltgerechtigkeit genährt. Es tut eben gut, den Untaten eines Umar al-Baschir nicht nur aus der Ferne hilflos zuzusehen, sondern auch darauf hoffen zu dürfen, dass der Haftbefehl aus Den Haag eines Tages in Vollzug gesetzt werden wird.
Gleichwohl muss man sich gerade dann, wenn die hochfliegenden Gerechtigkeitsträume von der Entscheidungspraxis frustriert werden, Funktion und Grenzen der internationalen Strafgerichtsbarkeit vor Augen führen. Es ist gar nicht die Aufgabe des ICC, in jeder Hinsicht den im nationalen Strafrecht entwickelten Maßstäben zu genügen. Wenn es den allgemeinen Strafverfolgungsbehörden gefallen würde, von drei in Frage kommenden Tätern einen einzigen herauszugreifen, würde man zu Recht von gesetzwidriger Willkür sprechen. Auch wenn gegen einen Mordverdächtigen nur wegen Diebstahls ermittelt würde, weil er das Auto des Opfers an sich gebracht hat, müsste die Staatsanwaltschaft mit harscher Kritik rechnen. Bei den Verbrechen, die in den Zuständigkeitsbereich des ICC fallen, ist hingegen der selektive Blickwinkel geradezu Funktionsbedingung der Institution. Angriffskrieg, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und sonstige Kriegsverbrechen lassen sich nicht flächendeckend aufklären. Zigtausende Mord- und Foltertaten in Krieg oder Bürgerkrieg können allenfalls symbolisch geahndet werden. Die Praxis, einzelne Leitfiguren herauszugreifen und nur die Verbrechen anzuklagen, die ohne den Hauch eines Zweifels nachgewiesen werden können, enthält zwar das Eingeständnis weitgehender Ohnmacht, verdient aber aus rechtsstaatlicher Sicht den Vorzug vor dem ungebremsten Strafverlangen, das geneigt ist, angesichts unbeschreiblicher Gräueltaten die Anforderungen an den Einzelnachweis hintanzustellen.
Das Lubanga-Verfahren ist insofern geradezu ein Lehrstück. Außer dem Angeklagten (der sich als kleines Rädchen unter vielen, als politischen Sündenbock für die Verbrechen anderer sieht) und vielleicht (wenn auch eher nicht) seiner Verteidigung gab es wohl niemanden im Gerichtssaal, der an der Berechtigung der Mord- und Foltervorwürfe gezweifelt hätte. Gleichwohl gelang es nicht, mit berechtigte Zweifel ausschließender Gewissheit die einzelnen Tatbeiträge dem Angeklagten zuzuordnen. Erschwert wurde dies übrigens durch Zeugenaussagen, von denen die drei Richter annehmen mussten, die Anklage hätte ihrer Eindeutigkeit etwas nachgeholfen: "Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass einige Verbindungsleute der Anklage Zeugen dazu ermuntert haben, vor diesem Gericht falsch auszusagen“ (so der englische Richter Fulford mit deutlicher Kritik in Richtung Anklagevertretung). Man muss es daher geradezu als Glücksfall bezeichnen, dass immerhin die Rekrutierung von Kindersoldaten durch den Angeklagten mit Hilfe eines Werbevideos, das ihn bei dieser Tätigkeit zeigt und seine menschenverachtenden Sprüche vernehmen lässt, mit der erforderlichen Sicherheit bewiesen werden konnte.
Zu wenig für so viel Aufwand? Keineswegs! Im symbolischen Charakter der Rechtsreaktionen liegt keine Abwertung der Prozeduren. Es gibt keine Möglichkeit, mit Hilfe des Völkerstrafrechts alle in Frage kommenden Täter und alle relevanten Tatbestände zu verfolgen. Die Tatbestände sind von nicht beherrschbarer Komplexität, die Zahl der Täter unüberschaubar, die Tatorte regelmäßig weit entfernt, die Ermittlungen durch hohe kulturelle Schranken und nicht zuletzt durch Sprachbarrieren behindert. Wer allumfassende Gerechtigkeit im Sinne des Legalitätsprinzips und des Gleichbehandlungsgrundsatzes für den Internationalen Strafgerichtshof fordert, hat damit die Bedingung seines Scheiterns mitformuliert. Insofern bekommt der, der vom Völkerstrafrecht und seinen Institutionen alles erwartet, überhaupt nichts, und der, der sich mit wenigem zufrieden gibt, immerhin den Funken Hoffnung, dass ein einzelnes rechtsstaatlich durchgeführtes Verfahren seine Botschaft auch in die Ecken der Welt und an die Adressaten transportiert, die üblicherweise von solchen Signalen nichts zu sehen oder zu hören bekommen: Für die einen Lichtblick, für die anderen – vielleicht – Schrecken. Mehr kann nicht erwartet werden.
mops-block
Justiz, Völkerstrafrecht und das Missverständnis von der Gerechtigkeit
- Details